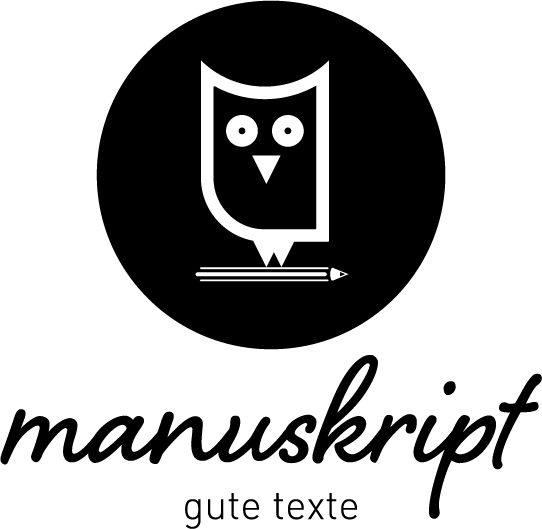In Zeiten der Sparpolitik geht das Gymnasium Köniz-Lerbermatt neue Wege und lässt sich eine der zwei neuen Mint-Klassen von einem Könizer Medizinaltechnik-Unternehmen finanzieren. Andere Gymnasien kritisieren dies als Wettbewerbsverzerrung.
Die Sponsoring-Debatte erreicht auch die Gymnasien. Was bisher ein Tabu war, hat das Gymnasium Köniz-Lerbermatt bereits umgesetzt: Die ortsansässige Firma Haag-Streit, ein internationales Schwergewicht im Bereich der Medizinaltechnik, finanziert eine der beiden Mint-Klassen, die im Herbst im Rahmen eines kantonalen Mint-Förderprojekts gestartet sind («Bund» vom 13. November). Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 187 000 Franken hat der CEO Walter Inäbnit der Schule als Defizitgarantie für vier Jahre zugesprochen - mit der Auflage, dass die Schule weitere Geldgeber sucht. «Es geht hier um Gönnerschaft, nicht um Sponsoring», betont die Mint-Projektleiterin Gabriele Leuenberger, Konrektorin des Gymnasiums. Die Schule gehe weder Verpflichtungen ein noch erbringe sie Gegenleistungen. Auch inhaltlich nehme der Gönner keinen Einfluss. «Den Lehrplan für den Mint-Unterricht bestimmen wir.»
«Notwendiges Engagement»
Das Interesse an der Mint-Klasse sei gross gewesen, doch habe das Geld des Kantons nur für eine Klasse gereicht, so Leuenberger. «Wir standen also vor der Wahl, Schüler abzulehnen oder andere Finanzierungsquellen zu suchen.» Ihr sei es aus gesellschaftspolitischen Gründen wichtig, dass alle Schüler - insbesondere die vielen interessierten Frauen - Zugang zum Mint-Angebot hätten. Die Schule gelangte an Inäbnit, der im Beirat der Mint-Klasse sitzt. Einsitz haben weitere Grössen aus Wirtschaft und Wissenschaft wie etwa der Herzchirurg Thierry Carrel von der Universität Bern oder BKW-Chefin Suzanne Thoma. Inäbnit ist bereits als Gönner und Sponsor der Universität Bern und der Fachhochschule Bern bekannt, bei ihm stiess das Gymnasium auf offene Ohren.
«Wir brauchen in der Schweiz unbedingt mehr Ingenieure und Naturwissenschaftler», sagt Inäbnit. Er habe daher nicht gezögert, das «ausgezeichnete Projekt» zu unterstützen. Es sei - gerade angesichts der aktuellen Kürzungen im Bildungsbereich - notwendig, dass sich die Wirtschaft stärker engagiere, «sonst wird die Schweiz langfristig nicht mit dem Ausland mithalten können». Einfluss auf Unterrichtsinhalte nehme er nicht, sagt Inäbnit, das brächte seinem international tätigen Unternehmen nichts. «Wir bieten der Klasse einzig unsere Hilfe an, geben gerne Inputs oder ermöglichen den Schülern einen Einblick in unsere Labors, falls dies gewünscht wird.» Auch Plätze für Praktika, die Bestandteil der Mint-Richtung sind, werden Haag-Streit und andere Unternehmen zur Verfügung stellen.
Mittel zur Weiterentwicklung
Wie vereinbart sucht das Gymnasium nach weiteren Geldgebern. «Wir werden insbesondere Stiftungen und lokal verankerte Firmen anfragen», sagt Bernhard Blank, stellvertretender Rektor des Gymnasiums. Er könne sich vorstellen, dass das Finanzierungsmodell in Zeiten des Sparens ein Modell für die Zukunft werde, es seien bereits weitere Projekte aufgegleist. Wichtig sei, dass das zusätzliche Angebot allen Schülern offenstehe und keine Elite fördere. Auch dürften Image und Neutralität der Schule nicht darunter leiden. Und: «Der obligatorische Unterricht darf auf keinen Fall privat finanziert werden, das ist Aufgabe des Staates.» Fakultative Fächer und Projekte privat zu finanzieren, sei jedoch legitim, sagt Blank. So könne sich das Gymnasium die nötigen Mittel schaffen, um sich weiterzuentwickeln und das Bildungsangebot den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen.
Das Pilotprojekt Mint solle am Gymnasium Köniz-Lerbermatt zum festen Bestandteil werden, sagt Leuenberger. Falls der Kanton - Bildungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) hat die Gönnerschaft genehmigt - das Projekt nach der Pilotphase nicht weiter unterstützen sollte, werde das Gymnasium den Unterricht weiter privat finanzieren. Zuvor müssen Gönner gefunden werden für eine dritte Mint-Klasse, die aufgrund des grossen Interesses bereits im Herbst 2014 nötig wird.
Vorwurf Wettbewerbsverzerrung
Bei der Konkurrenz kommt das Vorgehen nicht gut an. «Das gab es noch nie», sagt Rolf Maurer, Rektor des Gymnasiums Neufeld. Er erachtet es als «problematisch», wenn sich in der Schule Staatliches und Privates vermischte. Es seien Vereinbarungen möglich, damit der Unterricht nicht beeinflusst werde. Anders als bei Universitäten mit einem Forschungsauftrag gebe es bei Gymnasien weniger Bereiche, die beeinflusst werden könnten. Das grössere Problem sieht er im Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Gymnasien in Bern, «wenn eine Schule plötzlich bessere Projekte anbietet, nur weil sie den grössten Götti hat». Ein gewisser Wettbewerb sei wichtig, «es darf jedoch über Sponsoringbudgets kein Grosswettbewerb entstehen». Es sei darum gut, dass der Staat die Aufgaben definiere und auch finanziere.
Auch Elisabeth Schenk, Abteilungsrektorin am Gymnasium Kirchenfeld, spricht von einer Wettbewerbsverzerrung - diese habe jedoch bereits mit der Finanzierung der Mint-Projekte durch den Kanton begonnen. «Mit dem regulären Kostendach haben alle Schulen die gleichen Voraussetzungen und können Prioritäten setzen.» Noch sei dieser Spielraum vorhanden - trotz der kantonalen Sparübungen. Schenk steht einer Gönnerschaft durch Firmen grundsätzlich kritisch gegenüber. «Meiner Meinung nach müsste eine Schule dieser Grösse ein solches Projekt unter dem regulären Kostendach finanzieren können.» Wie bei Universitäten stelle sich die Frage nach der Abhängigkeit und der Einflussnahme: «Die Bildung ist und bleibt ein öffentlicher Auftrag.» Wenn ein Unternehmen eine Maturazeitung unterstütze, ein Instrument für ein Musikprojekt sponsere oder einzelne Schülerprojekte mitfinanziere, sei das unproblematisch. Bei einem Unterrichtsprojekt sei das jedoch anders: «Wenn Lehrerlöhne privat finanziert werden, überschreitet das eine Grenze.»
Das vierte Gymnasium im Berner Einzugsgebiet, das Gymnasium Hofwil, sieht das Ganze weniger kritisch: «Wenn gespart wird, ist es naheliegend, dass man auch andere Geldgeber sucht», sagt Rektor Peter Stalder. Gerade für ausgewählte Projekte, die zeitlich beschränkt oder aussergewöhnlich seien und einen Mehrwert für die Jugendlichen darstellten, könne er sich ein solches Finanzierungsmodell vorstellen. Wichtig sei, dass die Schule den Unterrichtsinhalt selber gestalten könne: «Der Lead muss bei der Schule sein.»
Auch Politik gespalten
Die Meinungen sind auch in der Politik gemischt. Grossrat Samuel Leuenberger (BDP) erachtet es als richtig, «wenn ein Gymnasium den Mut hat, unternehmerisch aktiv zu werden - vorausgesetzt, dass es nicht abhängig wird und eine Firma keinen Einfluss nehmen kann». Der grüne Grossrat und Solarpionier Urs Muntwyler, Professor für Fotovoltaik an der Fachhochschule Bern, sitzt im Beirat der Mint-Klasse und begrüsst die Lösung: Mint sei wichtig, und mit Inäbnit habe das Gymnasium Lerbermatt einen sehr guten Gönner gefunden. Er könne sich gut vorstellen, selber Gönner des Projekts zu werden. «Langfristig hätte ich jedoch Vorbehalte - die Schulen dürfen nicht zum langen Arm der Unternehmen werden», sagt Muntwyler.
Kein Geld ohne Gegenleistung
Es sei «naiv» zu glauben, dass eine Firma Geld gebe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sagt hingegen Roland Näf, Grossrat und Präsident der SP Kanton Bern. «Das Interesse der Firmen im Mint-Bereich liegt bei der Rekrutierung von zukünftigen Fachkräften.» Unabhängigkeit beginne im Kopf: «Wenn wir eine Beziehung zu einer Firma aufbauen, bleibt diese in unserem Kopf.» Das beginne bereits bei einem Firmenbesuch. Der Kontakt von Schülern zu Firmen sei zwar sehr wichtig, «aber dieser darf auf keinen Fall im Zusammenhang mit einer Gönnerschaft stehen.» Für ihn ist deshalb klar: «Die öffentliche Schule muss zwingend öffentlich und vollkommen unabhängig bleiben.»
Zur Sache
«Dies ist ein Einzelfall»
Herr Battaglia, sind Sponsoring und Gönnerschaft an Gymnasien schulpolitisch vertretbar?
Für uns ist wichtig, dass es sich um ein Gönnertum handelt und nicht um ein Sponsoring - die finanzielle Unterstützung ist also nicht an Bedingungen geknüpft, und es wird keine Werbung für die Firma gemacht. Weitere Kriterien für unser O. K. waren folgende: Es handelt sich um eine lokal verankerte Firma, und der privat finanzierte Unterricht ist fakultativ. Für die Finanzierung des obligatorischen Unterrichts ist der Kanton zuständig.
Der Gönner sitzt immerhin im Beirat und bietet Praktikumsplätze an. Wie kann eine Einflussnahme verhindert werden?
Der Beirat ist nur ein beratendes Gremium, und Praktikumsplätze gibt es auch in anderen Betrieben. Man muss dies aber sicher sorgfältig beobachten.
Wird dieses Finanzierungsmodell in Sparzeiten zum Zukunftsmodell?
Nein, sicher nicht. Es handelt sich hier um eine spezielle Situation, weil es sich um ein Projekt handelt, das zum Teil auch durch den Kanton finanziert wird. Die Schule stand vor der Wahl: entweder Schüler abweisen oder den Gönnerbeitrag annehmen. Dies ist ein Einzelfall.
Die Schule plant jedoch, das Projekt auch längerfristig über Gönner zu finanzieren.
Ein Gönner zahlt nicht ewig. Falls das Projekt zum Normalbetrieb wird, muss die Schule die Kosten innerhalb des regulären Kostendachs bewältigen.
Das Mint-Projekt ist ein fakultatives Angebot. Wo liegen die Grenzen? Was geschähe, wenn ein Gymnasium zum Beispiel die in der Sparrunde gestrichenen Russischlektionen als fakultatives Angebot privat finanzieren liesse?
Das wäre sicher nicht möglich, da es sich dabei um obligatorischen Unterricht handelt. Die Schulen müssen grundsätzlich jede Gönnerschaft mit uns absprechen. Wir gehen jedoch nicht von einem Flächeneffekt aus.
Die Gymnasien kommen mit jeder Sparrunde stärker unter Druck. Werden sie private Geldgeber brauchen, um sich zu profilieren?
Wir gehen nicht davon aus, dass dies notwendig ist. Jedes Gymnasium kann schon heute Schwerpunkte setzen, um sich zu positionieren. Das Gymnasium Neufeld etwa hat die Sportklasse, im Kirchenfeld gibt es die zweisprachige Maturität. (Interview: mry)
Zur Person
Mario Battaglia ist Vorsteher der Abteilung Mittelschulen in der Erziehungsdirektion.
Dieser Artikel erschien am 30. November 2013 im "Bund"
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript, Bern