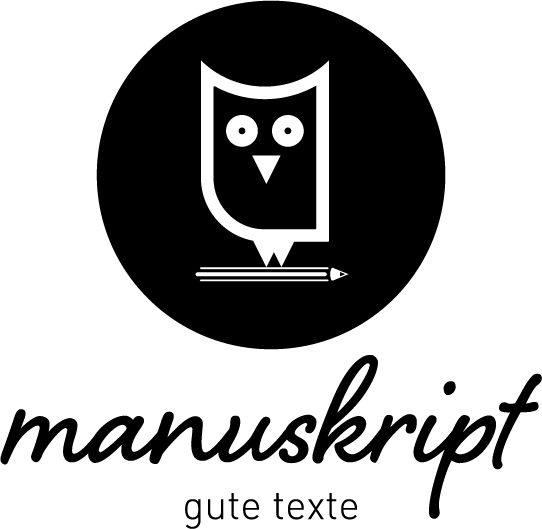das textbüro manuskript arbeitet neu für das bildungsprogramm einer stiftung im bildungswesen und übernimmt einen auftrag für text, kommunikation und beratung der textagentur etextera. als erstes steht die neue webseite an, ein langer forschungsbericht muss klar verständlich in einer kurzen und informativen broschüre publiziert werden und factsheets zu einzelnen projekten müssen aufgebaut und geschrieben werden. ich freue mich sehr auf diese spannende zusammenarbeit!
Apps sollen uns das Leben erleichtern – das ist das Credo der Berner Agentur Apps with love. Die Entwickler in der Lorraine wissen, was es für eine gute Applikation braucht.
Smartphones bestimmen unser Leben. Doch eigentlich sind es nicht die Funktionen der fortschrittlichen Handys, die uns an den Bildschirm fesseln, sondern die Apps, die diesen zum Leben erwecken. Es gibt Apps für jeden erdenklichen Nutzen. Wir wissen dank einer App, wann der nächste Bus in unserer Nähe fährt, wir überwachen unser Baby und zählen die Kalorien per App, wir pflegen unseren Freundeskreis über Apps und analysieren per App die Lawinengefahr. Vieles ist Spielerei, vieles Zeitverschwendung, manches nützlich.
«Eine gute App erleichtert uns das Leben», sagt App-Spezialist Beni Hirt. Er muss es wissen – seit vier Jahren produziert der Mitbegründer der App-Agentur Apps with love in der Berner Lorraine Smartphone-Applikationen. «Nur Apps, die wirklich nützlich sind und uns einen klaren Mehrwert bringen, setzen sich durch», sagt er. Der Knackpunkt sei, dass häufig nicht voraussehbar sei, ob eine App tatsächlich nützlich sein werde oder nicht – «sonst wäre Facebook schon viel früher erfunden worden».
Kreativität ist gefragt
Beni Hirt ist jung, seine schwarze Brille rundet seinen schicken, urbanen Stil ab. Der 33-jährige Berner gehört zu jenen, die das Potenzial des mobilen Internets früh erkannt haben. Bei einem Sofa-gespräch nach dem Pokern wälzten der Betriebsökonom und seine Freunde erstmals die Idee, selbst eine App zu entwickeln. Im Jahr 2010 gründete Hirt zusammen mit einem Designer, einem gadgetaffinen Lehrer und einem Software-Entwickler Apps with love.
Die damals initiierte Einladungs-App «Come on!» kam erst drei Jahre später auf den Markt. Doch bis dahin war aus dem Start-up mit der ursprünglich bescheidenen Geschäftsidee – der Entwicklung einer eigenen App – eine erfolgreiche Agentur mit 16 Mitarbeitern geworden. Mit Apps wie «Openair-Buddy» für die Swiss-com oder «Gleis 7» für die SBB festigte die Agentur ihren Platz im hart umkämpften Apps-Markt. Der unterschiedliche Hintergrund der vier Gründer unterscheide das Unternehmen bis heute von der Konkurrenz, sagt Hirt.
Denn bei App-Entwicklern ist viel Kreativität gefragt. Und diese flimmert im kleinen Büro von Apps with love regelrecht in der Luft. Apps werden hier nicht nur mit Liebe und Leidenschaft, sondern auch mit viel Know-how produziert.
Die Kunst der Entwicklung
Das Team von Apps with love weiss, was es für eine gute App – abgesehen von der guten Idee – noch braucht. «Eine gute App ist klar und einfach aufgebaut und hat ein tolles Design», sagt Hirt. Erst dann werde ihre Funktion für den Nutzer zugänglich. Bei den Apps gilt also, was im komplexen Leben immer seltener wird: weniger ist mehr. Hier liege die Kunst der App-Entwickler, sagt Hirt, «denn je einfacher eine App auf dem Bildschirm daher kommt, desto komplexer ist in den meisten Fällen ihre Entwicklung».
Eine gute App sei jedoch nicht in jedem Fall eine erfolgreiche App, sagt Hirt: «Eine App muss an die Massen, das braucht viel Zeit und ein grosses Marketingbudget.» Hirt und sein Team mussten dies bei ihren vier Eigenproduktionen schmerzlich erfahren. Mit eigenen Apps Geld zu verdienen, sei sehr schwierig, sagt Hirt – egal ob die App gratis mit Werbung oder für zwei Franken im App-Store erhältlich sei. Die in der Schweiz produzierten Apps seien daher meistens Marketinginstrumente. So etwa die von Hirt und seinem Team produzierte App «SBB Connect», mit der Reisende allfällige Facebook- und Twitterfreunde im gleichen Zug auffinden können.
Die Entwicklung im Apps-Bereich werde trotzdem massiv weitergehen, sagt Hirt, «das Potenzial ist noch riesig». So werde etwa im Bereich der Indoor-Navigation viel Neues kommen. «Apps werden uns beispielsweise im Laden zu den Aktionen führen», sagt Hirt. Zu was Apps sonst noch fähig sind, wird die Zukunft zeigen.
dieser artikel erschien am 20. mai 14 in der bz/bund-beilage "bildung".
text: manuela ryter, textbüro manuskript, bern
Zwei Professorinnen der Universität Bern machen es vor: Dank Jobsharing sind Familie und Karriere für Bettina Nyffenegger und Lucia Malär kein Widerspruch.
An der Universität Bern studieren mehr Frauen als Männer. Auch bei den Doktorierenden machen Frauen fast die Hälfte aus. Und trotzdem wird nur jede fünfte Professur von einer Frau besetzt. Dass es auch anders geht, zeigen Bettina Nyffenegger und Lucia Malär: Sie teilen sich seit 2011 am Institut für Marketing und Unternehmensführung eine Assistenzprofessur. Sie geben gemeinsame Vorlesungen und Seminare und forschen einzeln wie auch gemeinsam über Marken und Konsumenten. Mit Erfolg: Als Markenspezialistinnen haben sie sich in Wissenschaft wie auch in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht. Malär wurde Ende 2013 mit dem Marie Heim-Vögtlin-Preis des Schweizerischen Nationalfonds ausgezeichnet. Neben ihren Teilzeitpensen sind die Professorinnen an zwei Tagen pro Woche für ihre Kinder da.
"Die Idee, dass wir eine Professur teilen könnten, war eine Art Geistesblitz, als eine Professorenstelle frei wurde", sagt Malär, die 2008 kurz vor ihrer Promotion zum ersten Mal Mutter geworden war. Auch Nyffenegger wollte nur eine Teilzeitstelle, damit sie neben der Forschung auch in der Privatwirtschaft tätig sein konnte. Heute ist auch sie Mutter einer einjährigen Tochter. "Jobsharing eignet sich in der Forschung gut", sagt Nyffenegger – sofern auf persönlicher Ebene alles stimme. "Zwar gibt es einen Effizienzverlust, weil wir uns beide in ein Thema hineindenken müssen", sagt sie. Dafür sei der Austausch und somit auch der Output grösser: "Zu zweit haben wir doppelt so viele Ideen, wir hinterfragen unsere Arbeit häufiger, arbeiten fokussierter und setzen uns gegenseitig Deadlines." Auch bei den Studierenden komme die Abwechslung in den Vorlesungen gut an. Jobsharing sei eben mehr, als wenn zwei Leute Teilzeit arbeiteten: "Wir arbeiten als Team an einem Ziel", sagt Malär.
Noch sind sie auf ihrer Stufe mit diesem Arbeitsmodell die einzigen an der Universität Bern. Es brauche mehr Vorbilder, damit auch mehr Frauen eine akademische Laufbahn einschlagen, sagt Malär. "Und es braucht – neben Teilzeitstellen – flachere Hierarchien und mehr unbefristete Stellen im Mittelfeld, etwa Assistenzprofessuren. Dies gäbe den Frauen mehr Sicherheit und längerfristige Arbeitsperspektiven." Heute sei die akademische Laufbahn einzig auf das Ziel, irgendwann einen der wenigen unbefristeten Lehrstühle zu besetzen, ausgerichtet. Alle anderen Stufen seien nur Vorstufen mit befristeten Verträgen. Vielen Frauen sei es aber nicht so wichtig, "ganz nach oben" zu kommen: "Wir wollen in erster Linie forschen."
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript bern
Die gekürzte Fassung dieses Textes erschien im März 2014 im BERNpunkt, Magazin für Stadt und Region Bern (Wirtschaftsraum Bern).
Am Gymnasium Köniz-Lerbermatt können sich seit Semesterbeginn zwei Mint-Klassen in den Naturwissenschaften austoben. Das neue Angebot soll die Nachfrage nach technischen Berufen steigern. Einiges deutet darauf hin, dass das gelingt.
Das Hirn ist bereits etwas geschrumpft. Das gelbliche Stück Fleisch schwappt im Alkohol hin und her. Es ist ein Teil des Grosshirns, auch ein Stück des Kleinhirns hängt noch dran. Der Rest dieses Schweinehirns wurde von den Schülerinnen und Schülern der Mint-Klasse am Gymnasium Köniz-Lerbermatt abgetrennt und liegt nun in kleine Stücke geschnitten in flüssigem Paraffin im Wärmeschrank. Biologielehrer Peter Nyffeler erklärt seinen Schülern, weshalb es zur Weiterverarbeitung ihrer Präparate keine Wasserresten in den Hirnstücken haben darf. Und ermahnt sie: «Sie sollen nicht nur lernen, wie die Forscher Präparate machen, sondern auch, warum sie es so machen.»
Projekt mit politischem Ziel
Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es sind ebendiese Fächer, mit denen sich viele Schülerinnen und Gymnasiasten schwertun. Es sind jene Fächer, die den Ruf haben, trocken, theoretisch und kompliziert zu sein, und in denen es in der Wirtschaft an Fachkräften und vor allem an Nachwuchs mangelt. Besonders Frauen sind in diesen Bereichen nur wenige zu finden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat der Kanton Bern im vergangenen Jahr ein Projekt zur Förderung der Mint-Berufe lanciert. Unter anderem finanziert er auch eine der zwei neuen Mint-Klassen in Köniz - die ersten in der Schweiz -, die nun während der gesamten gymnasialen Ausbildung in zwei zusätzlichen Lektionen pro Woche in die Welt der Technik und der Naturwissenschaften abtauchen werden.
Hirn in allen Varianten
Es ist acht Uhr morgens, doch die sieben Schülerinnen und zehn Schüler gehen mit voller Konzentration an die Arbeit: Heute werden sie die kleinen Hirnstücke, die sie in einem langen Prozess entwässert haben, in Paraffinblöcken konservieren - um sie später gemeinsam mit den Profis am Naturhistorischen Museum sowie am Anatomischen Institut der Universität Bern in ultradünne Plättchen zu schneiden. Danach werden sie die Zellen und Strukturen der verschiedenen Hirnteile unter dem Mikroskop erforschen und miteinander vergleichen. «Wir können ins Hirn dieses Schweins hineinsehen und dann vielleicht auch verstehen, wie das menschliche Hirn aufgebaut ist und wie es funktioniert», sagt Etienne Hofstetter (17). Er sagt es nicht ohne Stolz, denn: «Wer hat schon die Möglichkeit, ein Hirn zu sezieren?»
«Think Mint - Denken in Netzwerken» ist das Thema des ersten Mint-Jahres - das Hirn ist der rote Faden der Lektionen. Vor den Herbstferien bauten die Schülerinnen und Schüler mit der Physiklehrerin einen Roboter aus speziellen Lego-Steinen und programmierten ihn. Dies sei eine Spielerei, aber auch eine Herausforderung gewesen, sagt Mario Trachsel (16): «Die Roboter mussten am Schluss durch ein Labyrinth gesteuert werden.» Man habe getüftelt und ausprobiert, bis die künstliche Intelligenz hergestellt war und funktionierte. Zeit zu haben zum Forschen und für viel Praxis statt Theorie, das sei das Tolle an Mint, sagt er. Seine Mitschüler nicken.
Vernetzung ist alles
Praktisch arbeiten die Jugendlichen jedoch nicht nur am Gymnasium. In der Sekunda, dem zweitletzten Jahr am Gymnasium, werden sie beispielsweise an der ETH Lausanne eine Woche lang in verschiedenen Bereichen arbeiten.
Nach der Robotik folgt die Anatomie. Und im Winter wird die Klasse ein Neuronennetzwerk konstruieren und der Reizverarbeitung des Gehirns auf die Spur gehen. «Mint verbindet Physik, Biologie, Chemie und Informatik miteinander - das macht das Projekt so spannend», sagt Etienne Hofstetter. Genau um diese Vernetzung gehe es, sagt Biologielehrer Nyffeler. «Die Schüler sollen lernen, in vernetzten Strukturen zu denken.» Vernetzung geschieht auch innerhalb der Klasse: Die Mint-Schüler haben im Gegensatz zu anderen Klassen verschiedene Schwerpunktfächer, von Musik bis Wirtschaft. «Da kommen verschiedene Denkweisen zusammen», sagt Seraina Bartetzko (16).
Mehr lernen dank Erlebnis
Sie macht sich nun mit ihrer Gruppe daran, «ihr» Hirnstück zu präparieren. Mit ruhiger Hand platzieren die jungen Frauen Winkel auf Glasscheiben, füllen die Öffnungen mit flüssigem Paraffin. Sie müssen den richtigen Moment erwischen, um das gelbe Stück Fleisch in die erkaltende Flüssigkeit zu geben. «Es ist extrem spannend, dass wir diesen Einblick erhalten», sagt Lea Hiller (15), «über das Hirn ist noch lange nicht alles erforscht, und es ist unvorstellbar, was es alles leistet.» Dieses Schweinehirn sei gar im Schweinekopf geliefert worden, «so konnten wir sehen, wie das Hirn im Kopf eingebettet ist». Als sie es rausgenommen hätten, sei es fast auseinandergefallen - das Hirn bestehe ja nur aus einem einzigen Strang.
Die jungen Frauen erzählen voller Begeisterung. Sie sind stolz, dass sie lernen dürfen, was sonst nur in Forschungslabors und Universitäten gemacht wird. «Es ist einfach der Wahnsinn, dass wir im ersten Gymerjahr die Möglichkeit haben, mit Profis von der Uni zusammenzuarbeiten», sagt Lea Hiller. Gerade für sie, die später Veterinärmedizin studieren will - das sei seit je klar -, sei dies von grosser Bedeutung.
Der Biolehrer ist zuversichtlich
Ob das politische Ziel, dass sich mehr Maturanden und vor allem Maturandinnen für ein naturwissenschaftliches Studium entscheiden, erreicht wird, ist offen. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch gross, sagt Biologielehrer Nyffeler. Denn: «Ausgerechnet im letzten Jahr, wenn es auf die Matura zugeht und die Studienwahl ein Thema wird, werden nach Lehrplan ausser Mathematik keine naturwissenschaftlichen Fächer unterrichtet. Dabei wären die Schüler dann geistig so weit, auch kompliziertere Sachen zu machen.» Die Mint-Klasse ermögliche nun ein Kontinuum, und man werde diese Schüler nach dem Gymnasium «motiviert in die Welt katapultieren». Das Praktische sowie die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Unternehmen machten die technischen Berufe fassbarer, sagen die Schüler: «Man kann konkreter an ein Studium oder einen Beruf herangehen, wenn man bereits einen Einblick hatte», so Mario Trachsel. Dies werde die Studienwahl erleichtern.
Mint-Klasse
Für 2014 schon 60 Anmeldungen
Von wegen Technikflaute - die Mint-Klasse ist ein voller Erfolg: Bereits im ersten Jahr meldeten sich mehr Schüler an als erwartet, weshalb mit zwei statt einer Klasse gestartet wurde. Das grosse Interesse zeige, dass die Gymnasien trotz vollem Lehrplan mehr Freiraum schaffen müssten für mehr Praxis und «fürs Forschen und Tüfteln», sagt Projektleiterin und Konrektorin Gabriele Leuenberger. Dies fördere die Kompetenzen sowie die Selbstständigkeit und die Vernetzung der Schüler. «Wir müssen die Gymnasien modernisieren und sie öffnen und vernetzen.» Wie viele Mint-Klassen ins Schuljahr 2014/15 starten werden, ist noch unklar - es haben sich bereits 60 angehende Gymnasiasten angemeldet. «Wir wissen noch nicht, wie wir mit diesem Ansturm umgehen werden», sagt Leuenberger. Man werde auf jeden Fall eine Lösung finden, denn das Gymnasium wolle nicht schon im zweiten Jahr Schüler abweisen. Umso weniger, als das Projekt eines der Ziele erreicht habe: Die Mint-Klasse begeistert auch junge Frauen. Im nächsten Jahr wird voraussichtlich fast die Hälfte der Teilnehmenden weiblich sein. (mry)
Dieser Artikel erschien am 13. November 2013 im "Bund".
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript, bern
Kaum publik, fliesst der Lehrplan 21 auch schon in die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ein. Laut Rektor Martin Schäfer von der PH Bern dürfte künftig die Benotung der Schüler noch zu reden geben.
Martin Schäfer, heute beginnt das neue Semester an der PH Bern: Als erste PH der Schweiz werden Sie die angehenden Lehrerinnen und Lehrer nach dem Lehrplan 21 ausbilden. Vieles ist jedoch noch nicht ausgereift. Ist es nicht zu früh?
Nein. Wir müssen jetzt anfangen, denn die mehr als 400 angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die heute ihre Ausbildung an der PH Bern in Angriff nehmen, werden diese 2016 bis 2018 abschliessen - genau dann, wenn der Lehrplan 21 im Kanton Bern eingeführt werden soll.
Der neue Lehrplan soll die Bildungsziele der Schulen in den 21 Deutschschweizer Kantonen harmonisieren. Wird er dieses Ziel erreichen?
Das hängt davon ab, was nun in den Kantonen passiert - ob sich dort der Geist, etwas Gemeinsames zu entwickeln, durchsetzt oder die lokal über Jahre eingeschliffenen Haltungen wie «Wir haben es bisher so gemacht, also machen wir es auch weiterhin so».
Dann stehen die Chancen schlecht? Im Bildungswesen ist der Föderalismus ja bekanntlich sehr stark.
Ich erwarte, dass es viele kantonale Anpassungen geben wird, und sehe daher ein Risiko, dass das Gemeinsame abgeschwächt wird. Das wäre schade, denn der jetzige Lehrplan 21 wäre eigentlich eine gute Basis für die Harmonisierung.
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver beschrieb den Lehrplan 21 nicht als Reform von oben, sondern als Weiterentwicklung der Schule von unten. Was heisst das für die PH?
Der Lehrplan 21 wird insbesondere den Unterricht beeinflussen. Er wird aber auch ein Anlass sein, die Schule als Ganzes zu entwickeln. Für die fächerübergreifenden Themen etwa werden die Lehrkräfte stärker zusammenarbeiten müssen. Als Hochschule müssen wir dies den Studierenden aufzeigen.
Bisher schrieben Lehrpläne vor, was eine Lehrerin im Unterricht durchnehmen muss. Nun legt der Lehrplan 21 fest, was ein Schüler nach der 2., 6., 9. Klasse wissen und können muss. Wie werden Sie die Lehrkräfte auf diese sogenannte Kompetenzorientierung vorbereiten?
Indem wir das Grundkonzept des neuen Lehrplans auch für die PH übernehmen. Wir haben die Studiengänge dafür komplett neu entwickelt.
Was haben Sie geändert?
Vieles. Erstens werden wir vom heutigen Tag an der PH noch stärker kompetenzorientiert lehren. Wie die Schulkinder stehen auch unsere Studierenden alle an einem anderen Ort, jede und jeder Einzelne bringt ein anderes Wissen mit - das Studium soll diesen individuellen Wegen Rechnung tragen. Was am Schluss zählt, sind die Kompetenzen, die eine Lehrperson haben muss, nicht der Weg dorthin. Zweitens setzen wir uns - wie künftig die Schulen - mit den überfachlichen Kompetenzen und drittens mit den fächerübergreifenden Themen auseinander. So werden wir etwa die Medienbildung in die Lehre integrieren, wie es künftig an den Schulen vorgesehen ist. Viertens haben wir die Fachbereiche angepasst. Was zum Beispiel auf der Sekundarstufe I bisher als Biologie, Physik und Chemie unterrichtet wurde, heisst Natur und Technik. Die künftigen Lehrkräfte dieser Stufe werden breiter ausgebildet: Bisher absolvierten sie drei Disziplinen, neu vier bis sieben. Ein guter Schritt.
Dann ist die PH gewissermassen ein Lehrplan 21-Versuchskaninchen?
Wir streben konkrete Kompetenzen unserer Absolventinnen und Absolventen an. Doch schaffen wir es auch, diese zu überprüfen? Wenn nicht - wie können wir dies dann von den Schulen erwarten? Längere Praktika sind dazu gut geeignet, doch in der Lehre sind wir noch am Suchen. Dies wird auch für Schulen ein wichtiges Thema sein.
Heisst das, es ist noch unklar, wie Schüler in Zukunft benotet werden?
Ja, diese Frage wird noch zu diskutieren geben. Kompetenzen können nicht ausschliesslich wie Wissen abgefragt und beurteilt werden. Auch wenn heute wieder eine Tendenz zu mehr Noten spürbar ist, wird die Diskussion über die Funktion und Rolle von Noten durch den Lehrplan 21 sicher wieder neu aufgeworfen. Da wird man hoffentlich über die Kantonsgrenzen hinweg nach Lösungen suchen.
Würden Sie die Abschaffung der Noten begrüssen?
Diese Lösung wäre sicher die konsequenteste Umsetzung der Kompetenzorientierung. Aber das würde im Moment kaum auf eine breite Akzeptanz stossen. Ich habe selbst zehn Jahre lang an einer öffentlichen Schule ohne Noten unterrichtet. Für die Schülerinnen und Schüler hatte dieses System keine Nachteile, aber für uns Lehrpersonen war es anspruchsvoller, die Leistungen der Schüler den Eltern zu kommunizieren.
Laut Erziehungsdirektor Pulver gibt es mit dem Lehrplan 21 keine grossen Änderungen im Kanton Bern. Ist der Schritt zur Kompetenzorientierung nicht ein Paradigmenwechsel?
Ich würde nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen - der Lehrplan 21 ist eher eine Evolution denn eine Revolution. Denn bereits der Lehrplan 95 enthält Kompetenzziele. Der neue Lehrplan ist da eine Erweiterung.
Gerade was die integrierte Medienbildung angeht, gibt es noch viele Fragezeichen. Und doch wird es gerade in diesem Bereich am meisten Aus- und Weiterbildung brauchen. Ist die PH parat?
Wir werden in der Aus- und Weiterbildung jene Dozierenden mit Medienwissen mit solchen aus andern Fachbereichen zusammenarbeiten lassen. Sie müssen gemeinsam ausarbeiten, was jeder in seinem Fach realisieren kann. Auch in den Schulen sollte jede Lehrperson ihren Anteil leisten können. Ein ganz natürlicher Umgang mit neuen Medien wird in Zukunft dazugehören. Und zwar in jedem Fach. Man darf diese Themen nicht nur Fachleuten überlassen.
Mit dem geplanten Bildungsmonitoring, einer Art Schweizer Pisa-Studie, werden es die Lehrer künftig jedoch schwarz auf weiss haben, wie effizient ihr Unterricht war.
Das ist so. Druck wird jedoch nur entstehen, wenn die Tests nicht richtig aufgebaut sind. Falls nur Wissen abgefragt wird, werden die Lehrpersonen nur noch darauf fokussieren. Sie werden auf Wissensbestände hinarbeiten statt auf Kompetenzen. Das muss verhindert werden.
Lehrplan 21 Mehr Kompetenz
Der Lehrplan 21 soll die Bildungsziele in den 21 Deutschschweizer Kantonen harmonisieren. Die erste Fassung ist in der Vernehmlassung. Die wichtigste Neuerung ist die Kompetenzorientierung. Ausserdem sieht er neben den Fachbereichen, die an die traditionellen Fächer knüpfen, überfachliche Kompetenzen (Eigenständigkeit, Selbstreflexion, Konfliktfähigkeit) und fächerübergreifende Themen wie berufliche Orientierung, Medienbildung und nachhaltige Entwicklung vor. Letztere sollen im Rahmen der anderen Fächer in den Unterricht einfliessen. 20 Prozent der Lektionen können die Kantone selbst gestalten. Mit dem Bildungsmonitoring, einer Art Pisa-Test, werden ab 2016 die Leistungen der Schüler stichprobenartig abgefragt. (mry)
Dieser Artikel erschien am 16. September 2013 im "Bund".
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript, bern
Seraina Bartetzko: Die 16-jährige Bolligerin mag Technik - sie besucht nun die erste Mint-Klasse des Gymnasiums Köniz-Lerbermatt.
Sprachen sind nicht ihr Ding. Wenn Seraina Bartetzko Franz-Wörtchen lernen muss, behilft sie sich mit Bildern. Die 16-jährige Schülerin, die vergangene Woche in Köniz mit dem Gymnasium begonnen hat, weiss, wo ihre Stärken liegen. Nicht in den Sprachen, sondern in der Technik. Im Forschen, Ausprobieren und Entdecken. Im vernetzten Denken und Analysieren. Statt vor dem Computer zu sitzen und Vokabeln auswendig zu lernen, baut sie lieber Brücken oder solarbetriebene Modellautos. Oder sie repariert auf dem Segelschiff auf dem Neuenburgersee eine Steckdose, montiert neue Beschläge oder harzt das Deck.
Die neue Mint-Klasse am Gymnasium Köniz-Lerbermatt (siehe Kasten) kam daher für Bartetzko wie gerufen. «Im ersten Semester werden wir uns dem Hirn widmen», sagt sie stolz. Sie freue sich jetzt schon darauf, eines zu sezieren. Oder einen Roboter zu entwickeln und zu programmieren. Die Informatik werde jedoch Neuland sein für sie: «Ich baue einen Computer lieber auseinander, als an ihm zu arbeiten.»
Technik und Naturwissenschaften hätten sie schon immer interessiert, sagt die Tertianerin. Sie sagt es leise, fast schüchtern, und doch mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit. Schon als kleines Kind habe sie ihrem Vater immer über die Schulter geblickt, wenn dieser am Werkeln und Reparieren war. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester lötete sie «Zeugs» zusammen, beobachtete Tiere oder besorgte auf dem Schiff den Ölwechsel. Zum Geburtstag wünschte sie sich einen Stimmverzerrer. Nicht um Musik zu machen, sondern um stundenlang zu erforschen, wie man mit Technik Stimmlagen verändern kann.
Endlich kann sie ihre Begeisterung mit anderen teilen. Zwar besuchte sie im Untergymnasium regelmässig ein Biologiepraktikum. Doch dort war sie immer das einzige Mädchen. Von den Buben wurde sie zwar akzeptiert - man lerne mit der Zeit, sich durchzusetzen. «Aber wenn es kompliziert wurde, schaute der Lehrer jeweils in meine Richtung und fragte, ob auch ich es begriffen hätte.» Diese Sonderbehandlung habe sie mit der Zeit genervt: «Ich wurde immer besonders behütet - weil ich das einzige Mädchen war.» Dabei habe sie viel mehr drauf gehabt als mancher Junge. In der Mint-Klasse ist sie nun nicht mehr die Einzige: 6 von insgesamt 16 Klassenkameraden sind Mädchen.
Trotzdem war es dieses Praktikum, das ihr Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern weckte. Es fasziniere sie, wie man mit Astronomie, Atomen und Mathematik konkrete Vorgänge verstehen könne, sagt Bartetzko. «In der Naturwissenschaft entdeckt man, wie etwas funktioniert, wie ein Endprodukt entsteht.» Wer technisch begabt sei, sei zudem weniger abhängig von anderen: «Mein Velo flicke ich jedenfalls selber.»
Die kleine, filigrane Frau kann ihre Begeisterung nun mit anderen Gymnasiastinnen teilen, sie ist jedoch immer noch in der Minderheit - die meisten Mädchen an Schweizer Gymnasien entscheiden sich für sprachliche oder musische Fächer. Weshalb? «In den Mint-Fächern muss man vernetzt denken und kombinieren», sagt Seraina Bartetzko, «viele Modis mögen das nicht, sie lernen lieber auswendig und entscheiden sich deshalb für Sprachen.»
Das liege an der Erziehung, ist sie überzeugt: «Vernetztes Denken wird bei Mädchen nicht gefördert.» Buben bauten mit Legos, während Mädchen mit Puppen spielten, «und die muss man ja nicht zusammenbauen». So würden Mädchen zurückgedrängt. Denn wenn ein Mädchen nicht schon als kleines Kind baue, forsche und entdecke, werde es sich auch in der Schule nicht für die technischen Fächer interessieren. «Im Untergymnasium jedenfalls fanden alle Mädchen ausser mir Chemie, Physik und Biologie langweilig. Oder es war ihnen zu kompliziert.» Dabei habe Technik viel mit dem Alltag zu tun, sagt Bartetzko. «Die Menschen haben die Umwelt mit Technik beinahe zerstört. Nun sollten wir unser technisches Wissen für die Natur einsetzen.» Wie die Ameisen, die als Gemeinschaft riesige Netzwerke aufbauen und Flüsse überqueren können. Mehr zusammenarbeiten: Das müsse in Zukunft die Devise sein. Ihre Zukunft sieht Seraina Bartetzko im medizinischen Bereich. Aber das könne sich noch ändern. Hauptsache, sie könne auch in ihrem zukünftigen Beruf etwas Praktisches tun, sagt sie. Drei Jahre hat sie nun Zeit, um sich zu entscheiden.
Gleich 13 Frauen wollen es wissen
Mit dem neuen Angebot der Mint-Klasse (Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist das Gymnasium Köniz-Lerbermatt auf grosses Interesse gestossen: 34 Schülerinnen und Schüler haben sich für die Klasse angemeldet. Man sei deshalb gleich mit zwei Klassen gestartet, sagt die Projektleiterin Gabriele Leuenberger. Die Schüler wählen wie alle anderen Gymnasiasten ein Schwerpunktfach, zum Beispiel Biologie/Chemie, Wirtschaft/Recht oder Musik. In zwei zusätzlichen Mint-Lektionen pro Woche werden sie ihr Wissen aus Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Mathematik in die Praxis umsetzen. Ausserdem können sie in Projektwochen und Praktika in Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen und Bundesverwaltung Berufsluft schnuppern und forschen. Mit diesem Angebot will Köniz-Lerbermatt das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Berufen und Studienrichtungen fördern. Ausserdem sollen Frauen, die in diesen Berufen massiv untervertreten sind, gefördert werden. 13 der 34 Schüler der beiden Mint-Klassen sind Frauen.
Dieser Text erschien am 19. August 2013 im "Bund".
Autorin: Manuela Ryter