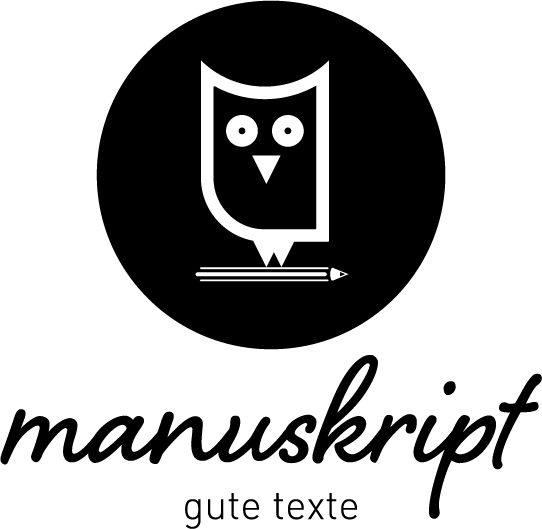Rania Bahnan Büechis erste Sitzung im Berner Stadtrat.
Auf der Treppe des Berner Rathauses wartet Rania Bahnan Büechi mitten im stolzen, um fünf Mitglieder gewachsenen GFL-Stadtratsgrüppchen. Etwas verloren steht sie da, elegant gekleidet in Jupe und Bluse, und lächelt verkrampft in die Kameras. Wie die anderen drei «Neuen» hält sie das grüne Pflänzchen, ein Begrüssungsgeschenk ihrer Fraktion, fest in ihren Händen.
·
Sie sei unglaublich nervös, sagt sie, «wie vor meiner Hochzeit». Rania Bahnan Büechi lacht beim Reden und schaut sich aufgeregt um. Der Platz vor dem Rathaus füllt sich allmählich, die Politiker trudeln ein und begrüssen sich zur ersten Sitzung des neu besetzten Stadtrats. Sie kenne kaum jemand von ihnen, sagt Bahnan. Kurz zuvor habe sie bei einer Einführung die 21 weiteren neuen Stadträte und Stadträtinnen kennen gelernt. Sie sei etwas zu spät gekommen, in der Aufregung an den falschen Ort gegangen. Sie sei heute sowieso etwas zerstreut - den Sitzplan habe sie vergessen, das Handy auch.
·
Bisher habe sie immer gedacht, es gehe ja erst im Januar los, jetzt aber gelte es ernst. Bahnan betritt das Rathaus, in der einen Hand die violette Jacke, in der anderen das Pflänzchen, und schaut sich etwas unsicher in der riesigen Eingangshalle um. «Schön ist es hier», sagt sie, als sie die Treppe hinaufsteigt und in die Wandelhalle mit den roten Sesseln kommt. Ein Hauch von Stolz gleitet über ihr Gesicht.
·
«Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Politikerin werde», sagt Bahnan. Mit ihrer Wahl habe niemand gerechnet, weder sie noch die Partei. Bis im Frühling 2004 war die Palästinenserin, die in Libanon aufgewachsen ist, in den USA studiert hat und 1992 mit ihrem Mann - einem Appenzeller - nach Bern kam, parteilos. Dann wurde sie von der GFL für eine Kandidatur angefragt. «Die Partei wollte Migrantinnen ein Gesicht geben», sagt sie.
·
Bahnan wurde überrumpelt. Heute freut sich die 41-Jährige jedoch, dass es so gekommen ist: «Es ist eine grosse Herausforderung, aber genau das mag ich.» Zwei Fraktionssitzungen hat sie schon hinter sich - die Themen «Wie halte ich eine Rede» oder «Wie mache ich ein Postulat» stehen noch an. Bahnan geht langsam in den Ratssaal, sucht ihre Parteikollegen und setzt sich an ihren Platz neben GFL-Fraktionspräsident Ueli Stückelberger. Das grüne Pflänzchen stellt sie vor sich aufs Pult. «Ich hoffe, dass es in den vier Jahren wachsen wird.»
·
Als Politikerin kennt man Bahnan in Bern noch nicht - als Expertin in Migrationsfragen hat sie sich jedoch einen Namen gemacht: In einem IKRK-Interventionszentrum fand sie ihren ersten Job in der Schweiz, dann wechselte sie zum Migrantinnenprojekt Wisdonna des Christlichen Friedensdienstes. Sie gründete die Fachstelle für Medizinische Hilfe für illegalisierte Frauen «MeBif», gibt neben ihrer Arbeit als Psychotherapeutin Kurse zum Thema Migration, ist in Vereinen für palästinensische Migranten aktiv, und bis vor kurzem sass sie in der Fachkommission für Integration der Stadt Bern.
·
«Migration und die Sans-papiers werden auch im Stadtrat meine Anliegen sein», sagt Bahnan. Sie habe nicht die Illusion, als Stadträtin die Welt zu verändern, «aber es wäre schön, in Bern etwas zu bewegen». Bei ihrer Arbeit mit den Migrantinnen sei sie immer wieder an «strukturelle Barrieren» gestossen, das habe ihr Bedürfnis, etwas zu verändern, geweckt.
·
Nun sitzt Rania Bahnan Büechi aber noch ruhig an ihrem Pult und hört gespannt der Begrüssungsrede des neu gewählten Stadtratspräsidenten Philippe Müller zu. Und als die Kommissionen gewählt werden, streckt sie mit den anderen ihre Hand hoch. Hilfsbereit deckt Stückelberger seine «Neuen» mit Erklärungen ein.
·
Als Migrantin Berner Politikerin zu sein, darauf ist Rania Bahnan Büechi stolz. Die Kandidatur habe sie jedoch viel Überwindung gekostet, «ich war - wie die meisten Migrantinnen - zu scheu», sagt sie. Die Hemmschwelle, in einem fremden Land politisch aktiv zu werden, sei riesig. Bern sei heute ihre Heimat. Politik sei eine Art, diese Heimat kennen zu lernen. «Ich will dort, wo ich wohne, auch partizipieren.» Bisher habe sie dazu nie Gelegenheit gehabt, denn: Seit ihrer Geburt lebte sie als Migrantin im Ausland - in Palästina war sie noch nie.
·
Früh ist die erste Stadtratssitzung beendet. Beim Apéro plaudert Bahnan gelöst und ruhig mit «bekannten Gesichtern» - die meisten aus der SP. Es sei schon eine andere Welt, sagt sie und lacht - sie fühle sich jedoch wohler, als sie gedacht habe. Sie lasse nun alles auf sich zukommen. Und dann werde auch sie etwas dazu beitragen, «dass ein neuer Wind aufkommt». Denn in Sachen Migration könne Bern diesen gebrauchen.
Text: Manuela Ryter
Dieses Feature erschien am 14. Januar 2005 im "Bund".