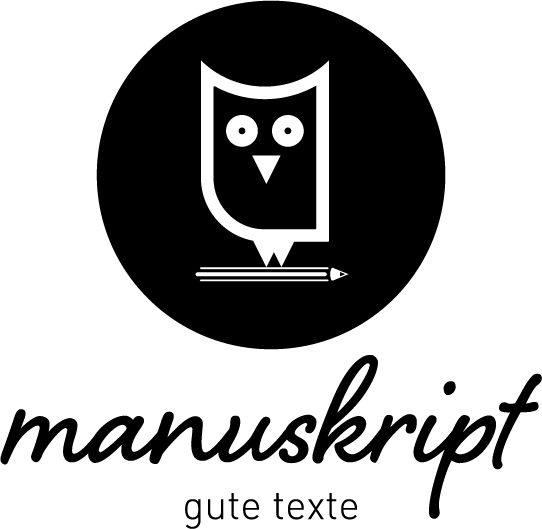Im Circus Monti werden nicht bloss Artistennummern aneinandergereiht – hier fügt sich das Programm zu einem Gesamtkunstwerk. Einen wichtigen Teil beigesteuert hat heuer der Berner Musiker Resli Burri.
Das Zelt des Circus Monti ist randvoll beider Berner Premiere gestern Nachmittag auf der Berner Allmend. Die Kinder sitzen still und gespannt da. Und dann kommen die drei Clowns, sie suchen den Anfang des Seils, das sie verbindet, und finden dessen Ende. Und sie merken: Sie sind nicht am Anfang und nicht am Ende, sondern im Mittelpunkt der Welt. Oder zumindest dieses Zelts.
Die Clowns sind philosophisch und romantisch, liebevoll und lustig. Und sie treffen den Humor der Kleinsten, indem sie nicht tun, als wären sie lustig, sondern indem sie authentisch sind. Wie die Kinder auch. Diese lachen, als hätten sie noch nie etwas so Lustiges gesehen.
Auch Resli Burri war gestern Abend wieder im Circus Monti. Weil er es geniesst, die «lieb gewonnenen Artisten» in der Manege schillern zu sehen. Weil er jedes Mal «überwältigt» ist von der «Magie» der Vorstellungen. Aber auch, weil es zur Aufgabe eines Zirkus-Komponisten gehört, sich die Vorstellung immer und immer wieder von Neuem anzusehen, um sicherzustellen, dass die Musik sich nicht verdreht hat von einer Vorstellung zur nächsten.
Massgeschneiderte Musik
Zirkusmusik war schon immer Thema in der Musik von Burri, heute bekannt durch die Comedy-Band Les trois Suisses. Bei Patent Ochsner schepperte und trötete Burri während acht Jahren an vorderster Front mit. Auch in seiner Theatermusik halten die Rhythmen und Klänge der Zirkusmusik immer wieder Einzug. Und dann kam der echte Zirkus und fragte nach seiner Musik.
Der Multiinstrumentalist lernte extra für den Zirkus Noten schreiben – ein wichtiges Kommunikationsmittel während der Vorstellung. «Zirkusmusik muss flexibel sein», sagt der 53-Jährige, «verliert der Jongleur einen Ball, muss die Musik mit einem Loop ausgedehnt werden.»
Burri zog für sechs Wochen ins Winterquartier des Circus Monti nach Wohlen. Er sah den Artisten beim Proben zu, er führte Gespräche mit dem Regie-Team – und zog sich dann zurück in «seinen» Zirkuswagen, um zu komponieren. Bei Minustemperaturen. «Es war sehr nüchtern, und es wurde sehr hart gearbeitet», erzählt er. Von romantischer Zirkusstimmung sei nicht viel zu spüren gewesen. Der Einblick in die Zirkuswelt sei eine «irrsinnige Erfahrung» gewesen, sagt Burri: «Die Musik stand nicht im Zentrum, sondern war lediglich Teil eines grossen Ganzen.»
Die Artisten im Monti sind jung und kreativ und sie verbinden ihre Kunststücke zu einem Ganzen. Die Clowns werden zu Artisten, die Akrobaten sind lustig. Und immer wieder sind sie alle gemeinsam in der Manege. «Der Monti ist der einzige Zirkus, der noch den Mut hat, poetisch zu sein», sagt Burri. Hier gebe es Kunst statt Bluff , und hier müsse auch nicht alles grösser, höher und lauter sein wie anderswo im Zirkuszelt. Im Monti dürfe es auch leise und sinnlich sein.
Teil dieses kreativen Ganzen, das eher der Strassenkunst gleicht denn einer traditionellen Zirkus-Show, ist auch Burris Musik. Er lässt einen Clown Banjo spielen, lernte einem anderen die Singende Säge. Auch Burris Musik hat den Mut, leise zu sein. Zu überraschen, ohne zu übertönen. Und manchmal auch zu schweigen.
«Zirkusmusik soll die Emotionen der Artistik verstärken und sich nie in den Vordergrund drängen», sagt er. Seine Zirkusmusik ist mal jazzig, mal lieblich, mal lustig im Balkan-Groove. Sie verzichtet fast ganz auf Zirkus-Klischees. Wie die gesamte Vorstellung des Monti auch.
Dieser Artikel erschien am 11. Oktober im "Bund".