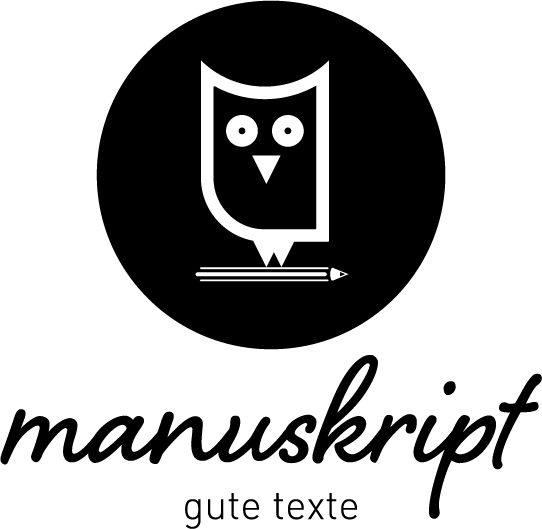im neuen bernpunkt, dem magazin des wirtschaftsraums bern, ging es um die wirtschaftskraft der kantone und des wirtschaftsstandorts bern – und um kultur. denn zu einer hohen lebensqualität trägt nicht nur das BIP bei. doch was kann kultur in unserer gesellschaft leisten? ich bin dieser frage nachgegangen. nachzulesen hier.
hab ganz schön was dazugelernt bei der recherche zu dieser titelgeschichte über butter und andere fette. erschienen ist sie im oliv, dem magazin des bio-fachhandels.
ein 16-seitiges kundenmagazin mit spannenden informationen, berichten und reportagen zum fahrplanwechsel.
auftraggeberin: casalini werbeagentur, bern
7 seiten text: manuela ryter, manuskript – das textbüro
In Businessfrauen-Organisationen vernetzen sich erfolgreiche Wirtschaftsfrauen. Sie geben ihr Know-how weiter, fördern jüngere Mitglieder und kämpfen für ihre Anliegen in der Wirtschaft. Ein Blick nach Bern.
artikel erschienen im oktober 2015 im BERNpunkt, magazin des wirtschaftsraums bern.
text: manuela ryter, manuskript – das textbüro für journalismus und corporate publishing.
geschäftsberichte sind beliebt. bei geschäftspartnern und investoren. bei kunden und mitarbeitenden. denn gut gestaltete und interessante geschäftsberichte zeigen die essenz eines unternehmens kompakt und spannend auf. sie unterstreichen die wertschätzung eines unternehmens gegen aussen und innen und sind daher die besten imageträger – sofern sie gut gemacht sind. und nur dann.
im auftrag der agentur bloom identity ging ich dem geheimnis des modernen geschäftsberichts auf die spur. wir sprachen mit professoren und jury-präsidenten, mit filmemachern und papierherstellern. 28 starke seiten für gute geschäftsberichte – und für gutes corporate publishing. www.corporategate.ch
texte und mitarbeit am konzept: manuela ryter, textbüro manuskript corporate publishing bern
auftraggeberin und projektleitung: bloom identity gmbh, bern
Upcycling ist, wenn dank Handwerk und Design aus Müll und Ausschuss Prachtstücke entstehen. Eine Titelgeschichte für die Bio-Fachhandel-Zeitschrift Oliv.
die aktuellste ausgabe lesen Sie hier.
text: manuela ryter, textbüro manuskript, bern
kunde: bosser & richter AG, Seon
und hier kommt sie schon, die zweite ausgabe des AST & FISCHER magazins.
die gesamte kundenzeitschrift lesen Sie hier.
text und konzept: manuela ryter, textbüro manuskript, bern
auftraggeber: ast&fischer AG
Der Vielfalt beim Zmorge sind kaum Grenzen gesetzt. Und doch wird an Frühstücksgewohnheiten selten gerüttelt.
dossier zum thema frühstück, erschienen im april 2015 in oliv, der kundenzeitschrift des biofachhandels. zur aktuellen ausgabe.
text: manuela ryter, textbüro manuskript, corporate publishing bern.
frisch gedruckt: das magazin corporate gate der berner agentur bloom identity zum thema corporate publishing.
redaktion, texte (ausser Interviews) und beratung: manuela ryter, textbüro manuskript, bern
auftraggeberin: bloom identity gmbh, bern
wie schön fühlt sich dieses magazin in den händen an. da wird man in zeiten der online-kommunikation geradezu nostalgisch. den kunden von ast & fischer wird es gefallen.
konzept, text und redaktion: manuela ryter, textbüro manuskript
auftraggeberin und projektleitung: bloom identity gmbh, bern
kunde: ast & fischer ag, wabern
Von Heidelbeere über Sauerkirsche bis Marroni, in veganer Qualität oder Fairtrade-zertifiziert: Die Auswahl an Bioglace ist so gross wie noch nie.
dossier zum thema bioglace erschienen im juni 2014 in oliv, der kundenzeitschrift des biofachhandels.
text: manuela ryter, textbüro manuskript, corporate publishing, bern.
Tiefblaue Seen, Wasserfälle, Alpenwiesen und bezaubernde Altstädte: Die schönsten Seiten der Schweiz lassen sich ideal mit dem Velo entdecken. Wir stellen Ihnen drei Routen vor.
artikel erschienen im mai 2014 im oliv, kundenzeitschrift des biofachhandels.
text: manuela ryter, textbüro manuskript, corporate publishing, bern.
2 porträts zum thema muttertag.
erschienen im mai 2014 im drogistenstern, dem magazin des drogistenverbandes.
text und konzept: manuela ryter, textbüro manuskript, corporate publishing, bern.
Zwei Professorinnen der Universität Bern machen es vor: Dank Jobsharing sind Familie und Karriere für Bettina Nyffenegger und Lucia Malär kein Widerspruch.
An der Universität Bern studieren mehr Frauen als Männer. Auch bei den Doktorierenden machen Frauen fast die Hälfte aus. Und trotzdem wird nur jede fünfte Professur von einer Frau besetzt. Dass es auch anders geht, zeigen Bettina Nyffenegger und Lucia Malär: Sie teilen sich seit 2011 am Institut für Marketing und Unternehmensführung eine Assistenzprofessur. Sie geben gemeinsame Vorlesungen und Seminare und forschen einzeln wie auch gemeinsam über Marken und Konsumenten. Mit Erfolg: Als Markenspezialistinnen haben sie sich in Wissenschaft wie auch in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht. Malär wurde Ende 2013 mit dem Marie Heim-Vögtlin-Preis des Schweizerischen Nationalfonds ausgezeichnet. Neben ihren Teilzeitpensen sind die Professorinnen an zwei Tagen pro Woche für ihre Kinder da.
"Die Idee, dass wir eine Professur teilen könnten, war eine Art Geistesblitz, als eine Professorenstelle frei wurde", sagt Malär, die 2008 kurz vor ihrer Promotion zum ersten Mal Mutter geworden war. Auch Nyffenegger wollte nur eine Teilzeitstelle, damit sie neben der Forschung auch in der Privatwirtschaft tätig sein konnte. Heute ist auch sie Mutter einer einjährigen Tochter. "Jobsharing eignet sich in der Forschung gut", sagt Nyffenegger – sofern auf persönlicher Ebene alles stimme. "Zwar gibt es einen Effizienzverlust, weil wir uns beide in ein Thema hineindenken müssen", sagt sie. Dafür sei der Austausch und somit auch der Output grösser: "Zu zweit haben wir doppelt so viele Ideen, wir hinterfragen unsere Arbeit häufiger, arbeiten fokussierter und setzen uns gegenseitig Deadlines." Auch bei den Studierenden komme die Abwechslung in den Vorlesungen gut an. Jobsharing sei eben mehr, als wenn zwei Leute Teilzeit arbeiteten: "Wir arbeiten als Team an einem Ziel", sagt Malär.
Noch sind sie auf ihrer Stufe mit diesem Arbeitsmodell die einzigen an der Universität Bern. Es brauche mehr Vorbilder, damit auch mehr Frauen eine akademische Laufbahn einschlagen, sagt Malär. "Und es braucht – neben Teilzeitstellen – flachere Hierarchien und mehr unbefristete Stellen im Mittelfeld, etwa Assistenzprofessuren. Dies gäbe den Frauen mehr Sicherheit und längerfristige Arbeitsperspektiven." Heute sei die akademische Laufbahn einzig auf das Ziel, irgendwann einen der wenigen unbefristeten Lehrstühle zu besetzen, ausgerichtet. Alle anderen Stufen seien nur Vorstufen mit befristeten Verträgen. Vielen Frauen sei es aber nicht so wichtig, "ganz nach oben" zu kommen: "Wir wollen in erster Linie forschen."
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript bern
Die gekürzte Fassung dieses Textes erschien im März 2014 im BERNpunkt, Magazin für Stadt und Region Bern (Wirtschaftsraum Bern).
Die jungen Berner Frauen haben in der Bildung aufgeholt: An den Berner Hochschulen studieren mehr Frauen als Männer. Auf dem Arbeitsmarkt können die top ausgebildeten Frauen ihr Potenzial jedoch auch heute noch nicht ausschöpfen.
Die Zeiten, in denen Frauen den Männern punkto Ausbildung nachhinkten, sind vorbei: Die jungen Frauen im Kanton Bern sind heute sogar etwas besser ausgebildet als die jungen Männer. Frauen sind an der Universität Bern mit 54 Prozent in der Mehrheit. Noch vor 30 Jahren sassen in den Berner Hörsälen nur ein Drittel Frauen. An der Pädagogischen Hochschule Bern sind Frauen mit über zwei Dritteln vertreten. Nur an der Berner Fachhochschule sind sie mit 42 Prozent in der Minderheit. Begründet wird dies unter anderem damit, dass viele junge Berner Frauen das Gymnasium besuchen, während sich junge Männer häufiger für eine duale Ausbildung mit Lehre, Berufsmaturität und Fachhochschule entscheiden.
Dies sind beachtliche Zahlen und sie liegen im Schweizer Durchschnitt. Die Studienrichtung wählen die jungen Frauen jedoch nach wie vor nach Stereotypen, ähnlich wie die angehenden Lernenden bei der Berufswahl. Auch wählen sie aus einem viel kleineren Spektrum an Fächern und Berufen als Männer. Im Kanton Bern studieren Frauen Recht, Medizin oder wählen ein Studium an der geisteswissenschaftlichen Fakultät. Oder sie bilden sich zur Lehrerin, Pflegefachfrau oder Designerin aus. In technischen Fächern wie Informatik, Technik, Architektur, Bau oder Wirtschaftswissenschaften sind sie zum Teil stark untervertreten.
Geringere Karrierechancen, weniger Lohn
So gut die Frauen ausgebildet sind – in der Arbeitswelt können sie ihr Potenzial auch heute nicht ausschöpfen. Gute Qualifikationen führen bei Frauen viel weniger häufig zu einem gut bezahlten Job als bei Männern: Fünf Jahre nach dem Masterabschluss besetzen 27 Prozent der studierten Frauen in der Schweiz eine Kaderstelle, nach einem Fachhochschulstudium 32 Prozent. Bei den Männern sind es 39 Prozent bzw. 50 Prozent. Und wenn die Kinder kommen, sinkt der Frauenanteil in Kaderpositionen weiter ab. Im Espace Mittelland waren 2012 16 Prozent aller erwerbstätigen Frauen Vorgesetzte. Bei den Männern waren es 24 Prozent. Auch an der Universität Bern wird nur jede fünfte Professur von einer Frau besetzt.
Auch bei den Besten der dualen Grundausbildung, jenen, die mit Auszeichnungen von Berufs- oder Weltmeisterschaften zurückkehren, gibt es keinen Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen, wie Ueli Müller, Unternehmer und Generalsekretär von SwissSkills, betont. Eine berufliche Karriere machten dann trotzdem vorwiegend die Männer, «weil die Frauen Kinder bekommen». Es sei die brutale Realität in der KMU- Welt, die die Schweiz präge, dass die Verfügbarkeit entscheidend für die Karriereentwicklung sei – da könne bereits der Mutterschaftsurlaub zum Problem werden. Teilzeit sei meist nicht möglich, schon gar nicht in einer verantwortungsvollen Position. Die Gesellschaft müsse aufhören, Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie Karriere machen wollten, sagt Müller. «Doch meine persönliche Erfahrung im KMU-Umfeld zeigt, dass viele Frauen kein Interesse mehr an einer Karriere haben, sobald Kinder da sind.»
Frauen stossen an gläserne Decke
Dieses Argument lässt Barbara Ruf von der Kantonalen Fachstelle für Gleichstellung nicht gelten: «Wir kämpfen dafür, dass Frauen wählen können. Und dies ist heute nicht der Fall.» Die Arbeitsanforderungen seien auf eine traditionelle, männliche Arbeitswelt ausgelegt: In einer Führungsfunktion arbeitet man Vollzeit und ist jederzeit verfügbar. Die grosse Mehrheit der Frauen mit Kindern im Kanton Bern arbeitet jedoch Teilzeit, während ihre Partner 100 Prozent arbeiten, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Statistik hervorgeht. «Frauen stossen in Unternehmen oft an eine gläserne Decke», sagt Ruf, «sie können ihre Qualifikationen, die sie aus der Ausbildung mitbringen, in der Berufswelt nicht gleich umsetzen wie Männer.» Viele gut qualifizierte Frauen wählten deshalb den Ausweg in die Selbstständigkeit – und fehlten somit in den Unternehmen. Es tue sich jedoch etwas, sagt Ruf, auch wenn die Fortschritte sehr klein seien. Etwa das KMU, welches eine Lösung findet für einen Vater, der sein Pensum reduzieren möchte, damit auch seine Frau arbeiten kann. Oder das grössere Unternehmen, das mit Mentoring gezielt Karrieren von Frauen fördert.
Für die Unternehmerin Christine Abbühl vom Frauenwirtschaftsverband Business and Professional Women Bern muss sich das Gesellschaftsbild, nach welchem «eine Mutter zu ihren Kindern gehört und ein Mann Vollzeit arbeitet», ändern, damit sich die Chancen für die Frauen verbessern können. Die jungen, aufstrebenden Frauen lebten in einem Irrglauben. «Sie sind überzeugt, dass es nicht nur in der Bildung, sondern auch im Beruf Chancengleichheit gibt.» Dies entspreche jedoch auch bei Frauen ohne Kinder nicht der Realität – und wenn sie dies merkten, sei die Enttäuschung gross.
Text: Manuela Ryter, textbüro manuskript bern
Dieser Text erschien im März 2014 im BERNpunkt, Magazin für Stadt und Region Bern (Wirtschaftsraum Bern).
Das swiss sport 5/09, Magazin von Swiss Olympic, erschien am 26. Oktober 2009.
Redaktionsleitung und Koordination: Manuela Ryter
Sportlerinnen und Sportler werden immer schneller, Weltrekorde purzeln seit den ersten modernen Olympischen Spielen. Damit soll bald Schluss sein, sagen Wissenschaftler. Doch Usain Bolt und Michael Phelps belehrten sie in Peking eines anderen. Wird der Mensch auch in Zukunft immer schneller? Oder sind die physischen Grenzen irgendwann erreicht?
Der Beste zu sein, die Schnellste, der Stärkste – das ist und war schon immer eine Triebfeder für jeden Sportler, der Hintergrund eines jeden Wettkampfs. Der Beste des Dorfs, der Schnellste der Stadt, die Stärkste des Landes, von Europa und schliesslich der Welt zu sein, dieses Streben nach Perfektion ist im Sport so verankert wie der Ball im Fussballspiel. Das höchste Ziel dabei: Der Beste aller Zeiten zu sein – einen Weltrekord aufzustellen.
Damit soll laut neusten Studien bald Schluss sein, die physischen Grenzen des menschlichen Körpers sollen bald erreicht sein. «Das Ende der Weltrekorde», titelten die Zeitungen im vergangenen Winter denn auch, als Jean-François Toussaint seine Studie präsentierte. Der Leiter des Instituts für Biomedizinische und Epidemologische Forschung des Sports (Irmes) sagte darin das Ende der Weltrekorde im Jahr 2060 voraus. Und zwar in allen klassischen Disziplinen.
In der Studie untersuchte der französische Wissenschaftler insgesamt 3263 Weltrekorde in allen klassischen Sportarten seit dem Beginn der Olympischen Spiele der Neuzeit 1896. Das Resultat: In allen Disziplinen werden die Sportler immer besser, immer schneller, immer stärker. Doch die Steigerungskurve flacht immer mehr ab.
Toussaint wendet diese exponentiell abfallende Entwicklung für eine Prognose der Zukunft an: Eines Tages wird die Kurve ganz flach und das Maximum erreicht sein. In der Hälfte aller Sportarten und Disziplinen soll dies bereits in 20 Jahren der Fall sein. Denn laut Toussaint haben wir heute bereits 99 Prozent der maximal möglichen Leistungsfähigkeit erreicht. In der Königsdisziplin 100-Meter-Sprint rechnet Toussaint mit einer noch möglichen Steigerung von 14 Tausendstel (Anfang 2008 lag der Weltrekord bei 9,74 Sekunden), im Marathon errechnete er die Leistungsgrenze bei 2:03:08 – 78 Sekunden unter dem damaligen Weltrekord. Der Körper stosse an seine Grenzen.
Leistungsgrenze bereits unterboten
Der Hohn am Ganzen: Die Ergebnisse der Studie hielten nicht einmal ein halbes Jahr stand, die Realität lehrte die Wissenschaft, dass sich die menschliche Leistungsentwicklung nicht in Kurven prognostizieren lässt. Usain Bolt liess die Wissenschaftler im Regen stehen: Die prognostizierte Leistungsgrenze von 9,72 Sekunden erreichte er bereits im Mai 2008. Und mit seinen 9,69 Sekunden, in denen er die 100 Meter an den Olympischen Spielen in Peking rannte (und zwar zum Erstaunen aller auf den letzten Metern bereits im abgebremsten Siegesschritt), unterbot er Toussaints prognostiziertes «Ende der Weltrekorde» um 36 Tausendstel.
Auch Schwimmer Michael Phelps und seine Kollegen liessen im vergangenen Jahr Wissenschaftler und Zuschauer perplex zurück. Ausgerechnet im Schwimmen, wo die Weltrekorde seit Jahren nur in winzigen Schritten purzeln, fielen heuer etliche Rekorde. In Peking gab es Rennen, in denen gleich mehrere Schwimmer unter der Weltrekordzeit anschlugen. Und auch im Marathon verbesserte Haile Gebrselassie seinen Weltrekord im September in Berlin um unglaubliche 27 Sekunden. Mit einer Zeit von 2:03:59 kommt er Toussaints Leistungsgrenze damit unerhört nah.
Bessere Technik, mehr Leistung
Ist ein Ende der Weltrekorde überhaupt voraussehbar? Oder wird sich der menschliche Körper stets weiterentwickeln? Wird der Mensch auch in Zukunft noch schneller, höher, stärker? «Wir sollten davon ausgehen, dass es immer eine Entwicklung geben wird», sagt Sportwissenschaftler Ralf Seidel von der Leistungsdiagnostik der Schulthess Klinik. Einen der Hauptgründe dafür sieht Seidel in der Entwicklung zukünftiger Technologien: «Sie werden das Training laufend verändern und eine kontinuierliche Leistungssteigerung ermöglichen.»
So hätten beispielsweise die Gegenströmungsanlagen den Schwimmsport massiv verändert. Mit Kameras und Messgeräten kann heute die Qualität des Trainings, die Motorik des Athleten und vieles mehr gemessen werden. «So etwas hätte man sich vor 50 Jahren nicht erträumt», sagt Seidel. Genauso wisse man nicht, welche Technik uns in 50 Jahren erwarte: «Wir werden nicht stehen bleiben.»
Es gebe im Leistungssport noch vieles, das nicht ausgeschöpft sei, sagt Seidel. So seien beispielsweise die Talentsuche und die professionelle Sportförderung noch in keiner Weise ausgereizt. Und auch in den Bereichen Ernährung, Schlaf und Sportpsychologie sieht er noch Lücken – sowohl in der Kenntnis darüber wie auch in der Anwendung des bisherigen wissenschaftlichen Wissensstands: «Da ist noch Verbesserung möglich.» Auch sei die Trainingswissenschaft noch eine junge wissenschaftliche Disziplin, die sich weiterentwickle. «Wenn man schaut, wie man vor 40 Jahren trainierte, kann man heute über die Trainingspläne von damals schmunzeln.»
Wird also nie eine physiologische Grenze erreicht werden? Entscheidend für eine kontinuierliche Leistungssteigerung sei die Steigerung der Qualität des Trainings sowie der Belastbarkeit der Athleten, womit mehr und intensiveres Training möglich werde. Wenn zusätzlich die Erholung – zum Beispiel durch Schlaf und Ernährung – verbessert werde, sei wiederum eine Leistungssteigerung möglich. Ob physiologische Grenzen irgendwann erreicht werden, «spielt gar nicht so eine wichtige Rolle», sagt Seidel. Denn schlussendlich garantiere die beste körperliche Leistungsfähigkeit nicht, dass man am Tag X die Leistungen auch abrufen könne. Zu viele Faktoren, etwa mentale, spielten da eine Rolle. Diese in eine Formel zu packen und daraus Prognosen aufzustellen, sei deshalb rein hypothetisch.
Das von Toussaint erwartete Ende der Weltrekorde dürfte also noch fern sein. Unbestritten ist jedoch: Die Schritte, in denen es aufwärts geht, werden immer kleiner. Weshalb sie jedoch beispielsweise im Schwimmen gerade ansteigen statt kleiner werden, ist allerdings auch den Wissenschaftlern ein Rätsel. Klar zu sein scheint, dass die Steigerung nicht nur auf die neuen Schwimmanzüge zurückzuführen ist, wie dies auch die Hersteller bestätigen.
Weltrekorde nur mit Doping?
Sind Weltrekorde also nur noch mit Doping machbar? So wurden beispielsweise zwölf aktuelle Weltrekorde der Frauen in der Leichtathletik in den 80er Jahren aufgestellt – in der Hochphase von Anabolika. In jener Zeit, als Dopingkontrollen nur an Wettkämpfen, nicht aber im Training durchgeführt wurden. Auch die heutigen Kugelstösser sind weit von den Weltrekorden der 80er Jahre entfernt. Dies spricht wiederum gegen Studien, die Leistungsgrenzen aufgrund von früheren Weltrekorden voraussagen, da sie sich auf zum Teil verfälschte Daten stützen. Laut Toussaint erreicht Doping zwar lediglich, dass die Leistungskurve schneller ansteigt – die physiologische Grenze werde mit Doping jedoch kaum verschoben, denn es sei schon immer gedopt worden, geändert hätten sich nur die Methoden. Allerdings: Ob gerade Gendoping die physiologischen Grenzen künftig nicht doch illegal übergehen könnte – diese Diskussion wird künftig sicherlich im Zentrum stehen, sollten eines Tages die Weltrekorde wieder auffällig schnell purzeln.
Dieser Artikel erschien am 22. Dezember 2008 im swiss sport 6/08, Magazin von Swiss Olympic.
Text: Manuela Ryter
2004 wurde Nino Schurter Junioren-Weltmeister, in Peking holte er nun Bronze. Der Weg des 22-jährigen Bikers führt steil nach oben. Dank viel Talent, Glück und angemessener Förderung.
Nino Schurter sitzt im «Café Maron», direkt am Bahnhof in Chur, auf einer mit Seide überzogenen Bank. Neben ihm nippen alte Damen an ihren Cappuccinos und stecken ihre Gabeln tief in klebrig-süsse Kuchen. In grau-schwarz gestreiftem Hemd sitzt er da, die blonden Haare elegant zur Seite gekämmt. Hübsch, jung, bescheiden und stets mit dem Lächeln des netten Jungen von nebenan im Gesicht.
Der Medienrummel der letzten Wochen hat Schurter ein professionelles Auftreten gelehrt. Seit er im August in Peking beim Cross Country-Rennen vor dem zehn Jahre älteren Landsmann Christoph Sauser als Dritter ins Ziel kam und die einzige Schweizer Medaille der Biker in Empfang nahm, ist Schurter ein gefragter Mann. Überall soll der laut Presse «talentierteste Biker der Welt», der bereits als Nachfolger des französischen Seriensiegers Julien Absalon gefeiert wird, mit dabei sein. «Das ehrt mich natürlich», sagt Schurter. Doch das Leben geht für ihn auch nach einer Olympiamedaille weiter wie bisher. London 2012 wartet.
Wenn Nino Schurter in London Gold holt, wird dies niemanden überraschen. Zu steil ging sein Weg stets nach oben, als dass ihm jemand diesen Exploit nicht zutrauen würde. Aufs Bike sass Schurter bereits als kleiner Junge, damals in Tersnaus, einem winzigen Dorf in den Bündner Bergen. Wie sein Bruder fuhr er erst einmal Skirennen, wie das die meisten sportlichen Kinder in einem Bergdorf tun. Im Sommertraining ging es auf dem Velo in die Berge und bald brausten die Schurter-Brüder auf Bikes statt auf Skis die Berge hinunter. «Wir hatten von Anfang an Erfolg.»
Auch sein Vater liess sich vom Bike-Virus anstecken. In die Ferien ging die Familie Schurter fortan nicht mehr ans Meer, sondern mit dem Bike in die Berge Italiens. Ninos Bruder wechselte später nach einem Unfall zum Downhill, sein Vater ist noch heute Trainer der Schweizer Downhill- Nationalmannschaft.
Viel Training dank Sportlerlehre
Als 16-Jähriger entschied sich Schurter für den Spitzensport. Er verliess sein Elternhaus und zog nach Bern, um dort eine Sportlerlehre zum Mediamatiker zu absolvieren, einer Mischung aus IT, Kaufmännischer Ausbildung und Multimedia-Design. Drei Jahre lang ging er Teilzeit in dieBerufsschule, die ihm viel Zeit fürs Training ermöglichte. Anschliessend machte er ein zweijähriges Praktikum bei einer Werbeagentur, bei der er für die Werbeunterlagen seines Teams, dem Swisspower MTB-Team, zuständig war. «Mein Teamchef war somit indirekt auch mein Chef und sorgte dafür, dass ich genügend zum Trainieren kam», sagt Schurter schmunzelnd.
Der Einsatz zahlte sich bald aus: 2004 wurde Schurter bei den Junioren Welt- und Europameister, als 19-Jähriger Dritter bei der U23-WM und ein Jahr später holte er die U23-Welt- und Europameistertitel, seither ist er in dieser Kategorie fast ohne Konkurrenz. Auch bei den Weltcuprennen in der Elite fährt er seit zwei Jahren vorne mit. Und nun die Olympiamedaille. Nino Schurter, der seit seinem Lehrabschluss vor einem Jahr und der Spitzensport-RS im vergangenen Winter Profibiker ist, sieht der Zukunft zuversichtlich entgegen. «Bisher war das Glück häufig auf meiner Seite.» Er hoffe, dass ihm nun auch der Anschluss an die Elite gelinge.
Erfolg nur dank Unterstützung
Schurters sportliche Laufbahn gleicht einer Bilderbuchkarriere. Während in der U23-Kategorie viele seiner einst genauso talentierten Kollegen den Sport wegen ausbleibender Erfolge an den Nagel hängten, geht der Rätoromane seinen Weg nach oben. Die Medaille in Peking war nun die Krönung. Dabei wäre er schon mit einem Diplom überglücklich gewesen, sagt Schurter. Er sei nicht mit dem einzigen Ziel, Gold zu holen, an den Start gegangen. «Ich habe noch viel Zeit», sagt Schurter. Wenn alles gut laufe, wolle er noch mindestens zwei Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Denn sein Potenzial sei noch nicht ausgeschöpft: «Ich weiss, dass mein Körper noch stärker werden kann, das gibt mir Sicherheit.»
Aber im Sport müsse alles stimmen, damit man Leistungen zeigen könne. Bisher habe er viel Glück gehabt. Er habe sich nie schwerwiegend verletzt und sei stets grosszügig unterstützt worden: In erster Linie durch seine Eltern und Grosseltern, aber auch durch Swiss Olympic, die Sporthilfe und den Club Sport Heart. Heute könne er gut vom Sport leben. «Aber gerade in den Junioren-Jahren war die Förderung enorm wichtig», sagt Schurter. Auch habe ihm die Sportlerlehre ermöglicht, eine gute Ausbildung zu machen, viel zu trainieren und trotzdem Zeit für Freunde und seine Freundin zu haben.
Er gehe auch mal aus, fahre häufig Ski oder spiele ab und zu Golf. Dieser Ausgleich sei ihm immer wichtig gewesen. «Hätte ich eine normale Lehre machen müssen, wäre ich wohl nicht beim Spitzensport geblieben», sagt Schurter, «ich wäre nicht bereit gewesen, für den Sport alles aufzugeben.» Der Spass sei ihm immer sehr wichtig gewesen. Er kenne Athleten, die morgens um sechs Uhr trainierten, dann den ganzen Tag im Lehrbetrieb arbeiteten und abends wieder aufs Bike stiegen. «Das hätte ich nicht lange gemacht. Ich bin nicht der Typ dazu.»
«Nachwuchsförderung könnte noch besser werden»
Die Nachwuchsförderung könnte laut Schurter aber noch besser werden. Denn es sei wichtig, dass es einem gut gehe. «Der Kopf ist zentral im Sport. Wenn dort etwas nicht stimmt, kann man noch so gut in Form sein, erfolgreich ist man nicht.» Die Doppelbelastung mit Sport und Beruf, die eine normale Lehre mit sich bringe, berge die Gefahr, sich zu überfordern, und bei Sportlerausbildungen seien die Möglichkeiten in der Berufswahl eingeschränkt. Doch eine gute Ausbildung sei wichtig, da der Sport viel zu unsicher sei. «Ich habe sehr früh auf den Sport gesetzt und es hätte auch anders kommen können: Man weiss nie, ob man den Anschluss an die Elite schaffen wird.»
Hätte er es nicht geschafft, hätte er ein paar Jahre verloren, da die Sportlerlehre etwas länger dauerte, aber wenigstens eine gute Ausbildung gemacht. Auch die Weiterbildung sei ihm wichtig, sagt Schurter, er werde jeweils im Winter Zeit dafür investieren. «Man muss als Sportler auch an ein Leben nach dem Sport denken.» Denn man wisse nie, wann man die Leistungen nicht mehr erbringe oder wegen einer Verletzung aufhören müsse. Er wolle sich in Richtung Marketing weiterbilden. «Ich kann mir vorstellen, später einmal in der Velobranche tätig zu sein.» Aber das sei noch so weit weg. Nur weil Schurter nun bereits eine Olympiamedaille im Palmarès hat, ist sein sportlicher Ehrgeiz noch lange nicht versiegt.
Dieses Porträt erschien am 27. Oktober 2008 im swiss sport 5/08, Magazin von Swiss Olympic.
Text: Manuela Ryter
Er war einer der kräftigsten Turner und der beste an den Ringen: Karl Frei gewann vor genau 60 Jahren Olympiagold in London. Während er im Fernsehen die Kunstturner in «Beijing» kritisch beobachtet, erzählt der 91-Jährige, wie er die ersten Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung hat.
Zwei Chinesen und sechs Europäer seien im Finale der Ringe-Turner in Peking, berichtet der Kommentator am Fernsehen während der Live-Schaltung aus Peking. Schweizer sind keine dabei. Die Zeiten, als die Eidgenossen im Turnen noch auftrumpften, sind lange her. Karl Frei sitzt gemütlich in seinem Sessel vor dem Fernseher, über dem ein grosses Plakat von den Olympischen Spielen 1948 hängt. «Gleich drei Goldmedaillen haben die Schweizer Turner aus London heimgebracht», sagt der rüstige, 91-jährige Mann.
Frei zeigt auf die Bilder an der Wand in seinem Einfamilienhaus in Regensdorf, wo er seit seiner Kindheit lebt. Auf einem der alten Fotos ist ein Turner mit angespanntem Gesicht zu sehen, die Hände fest an die beiden Ringe gekrallt, die Beine waagerecht nach vorne gerichtet, die Muskeln der Arme aufgebläht und eisern. «Das bin ich», sagt Frei stolz. Ja, kräftig sei er tatsächlich gewesen – einer der kräftigsten Turner überhaupt. Deshalb sei er schliesslich auch Olympiasieger geworden: Weil die Konkurrenz für die Abfolge der Übungen, die Frei zeigte, schlicht zu wenig kräftig war. Während sich die Athleten in Peking aufwärmen, zieht der alte Mann seine Pantoffeln aus, steigt auf die Eckbank und öffnet den Wandschrank, in dem er seine bedeutendsten Auszeichnungen aufbewahrt. «Das war noch eine richtige Medaille», sagt Frei, «nicht so eine zum Umhängen.» Heute ist der 91-Jährige der älteste noch lebende Schweizer Olympiasieger.
«Wir wussten kaum, was eine Olympiade ist»
Am Fernsehen ist nun Iovtchev Iordan, der erste Turner des Ringe-Finals in Peking, zu sehen. Frei verstummt und beobachtet ihn gespannt. Wie er an die Ringe hochgehoben wird. Wie er mit angespannten Armen die Beine beugt und hebt, in den Handstand übergeht und mit ganzer Kraft schwungvoll seine Kür turnt. Diese Schwungteile habe man damals noch nicht geturnt, sagt Frei. Deshalb könne man die Athleten auch nicht vergleichen. «Heute haben sie ‹Rölleli› in den Handschuhen, das ist eigentlich ein Schwindel. Wir haben noch mit blossen Händen geturnt.» Die Kraftteile der heutigen Turner seien aber nicht anders als bei ihnen damals. «Wir waren damals auch Muskelprotze», sagt er, «diese Kraft braucht es halt an den Ringen.» Deshalb hätten sich die Ringe im Gegensatz zu den anderen Disziplinen im Kunstturnen auch kaum verändert.
Dafür war damals sonst alles anders an den Olympischen Spielen. London lag in Schutt und Asche, die Athleten hatten laut Frei untereinander kaum Kontakt. Und Olympia hatte noch nicht eine so grosse globale Bedeutung wie heute. «Es gab ja noch kein Fernsehen», wirft Freis Frau Ruth ein. Einzig in der «Wochenschau» im Kino sei vielleicht mal etwas über die Olympischen Spiele berichtet worden. «Damals wussten wir hier auf dem Land kaum, was eine Olympiade ist», sagt Frei und lacht heiter. Für ihn sei Olympia jedenfalls wie jedes andere Turnfest gewesen. Und sogar in London habe nicht jeder gewusst, dass die Olympischen Spiele stattfanden.
Als Schweizer strenger benotet
Alexander Worobjew, ein Ukrainer, ist an der Reihe. Stramm zeigt er seine Übungen. Exakt und kraftvoll. 16,325 Punkte erhält er für seine Kür. «Das ist ja verrückt», sagt Frei und schüttelt den Kopf. Einen Unterschied zu früher gebe es eben schon: «Wir waren damals Amateure, heute sind alle Profis.» Dreimal die Woche hatte Frei in Regensdorf trainiert – zuerst in einem Weinkeller, dann in einem eigens gebauten Turnschopf. Die nötige Kraft habe er von der harten Arbeit als Schmid und Abwart gehabt: «Ich musste nie in den Kraftraum.» Trotz dem geringen Training sei er im Dorf immer wieder «angezündet» worden: «Die Bauern sagten, ich solle doch arbeiten statt ‹umegumpe›.»
Schweigend schaut Frei die nächste Kür – als Profi, der mit Argusaugen anderen Profis kritisch zuschaut. Yang Wei, der muskulöse Chinese, der nun seine Kür zeigt, beeindruckt Frei nicht. Diesen Schwierigkeitsgrad habe man damals schon geturnt. Einzig «solche Abgänge hat damals noch keiner gemacht», sagt Frei, nachdem Wei seine Kür mit einem Doppelsalto gestreckt mit Doppeldrehung abgeschlossen hat, «wir sind gar nicht auf die Idee gekommen.»
Ganz automatisch mache er die Noten jeweils selber, sagt Frei, als auch der nächste Athlet fertig geturnt hat. Er sei nicht immer einverstanden mit den Kampfrichtern. Frei zuckt mit den Schultern: «Was will man machen?» Bereits als Athlet habe er jeweils akzeptieren müssen, wenn er strenger bewertet wurde als die anderen. Wie etwa damals, in London: «Es hiess, die Schweizer hätten keinen Krieg gehabt und über all die Jahre trainieren können», sagt er, «das stimmte nicht.» Auch die Schweizer seien eingezogen worden. Und im Winter habe man den Turn- schopf nicht heizen können. Nur am Sonntagmorgen, da sei er manchmal um fünf Uhr früh aufgestanden, habe Kohle aus dem Schulhaus in den Schopf gekarrt und geheizt.
Sein Name wurde in London verewigt
Frei beobachtet gespannt, welche Figurenabfolgen die Athleten turnen. Seine Faszination fürs Turnen ist ihm ins Gesicht geschrieben, seine Leidenschaft, die er bis 65 aktiv ausgeübt hat, deutlich zu spüren. Heute mache er nur morgens noch ein paar Turnübungen, sagt Frei. Seinen grossen Garten bestellt er immer noch selbst. Und täglich fährt er mit dem Velo zur Post. Einzig auf Bäume klettere er nicht mehr, seit er vor ein paar Jahren beim Äste sägen heruntergefallen sei.
In Peking geht es nun um die Olympiamedaille, die letzten Turner zeigen ihr Können. Und bald steht fest: Der Chinese Chen Ybing holt Gold, auch Silber geht an China, Bronze an die Ukraine. Was er damals gefühlt habe, als er auf dem Podest stand und den Schweizer Psalm hörte? Das wisse er nicht mehr, sagt Frei. Man vergesse so vieles. Aber wenn er nun die Spiele schaue, kämen viele Erinnerungen hoch. Viel Publikum hätten sie damals nicht gehabt, erzählt er, es habe in Strömen geregnet. «Der Wettkampf musste immer wieder verschoben werden.» Nach drei Tagen und drei schlaflosen Nächten sei er «kaputt» gewesen wie noch nie. Geturnt hat er dann trotzdem besser als alle anderen. «Gold und Silber gingen an die Schweiz, Bronze an Tschechien», sagt Frei stolz und erinnert sich, wie er nach der einwöchigen Rückreise per Schiff und Zug in Regensdorf empfangen wurde: Das ganze Dorf feierte ihn wie einen Helden und führte ihn mit einer Kutsche hinter der Blasmusik her durchs Dorf.
Von London habe er jedoch nicht viel gesehen, sagt Frei. Erst ein paar Jahre später sei er mit seiner Familie zurück gegangen, um sich das Stadion noch einmal anzusehen. «Als ich dann auf einer Tafel mit allen Gewinnern meinen Namen fand, war das schon speziell, da habe ich schön dumm geschaut.» Erst in diesem Moment sei ihm bewusst geworden, was eine Olympiamedaille bedeute.
Diese Porträt erschien am 27. Oktober 2008 im swiss sport 5/08, Magazin von Swiss Olympic.
Text: Manuela Ryter
Fotos: Luc-François Georgi
Das swiss sport 5/08, Magazin von Swiss Olympic, erschien am 27. Oktober 2008.
Redaktionsleitung und Koordination: Manuela Ryter