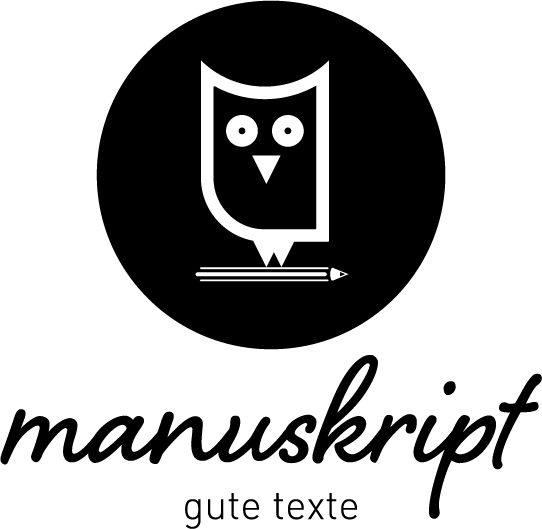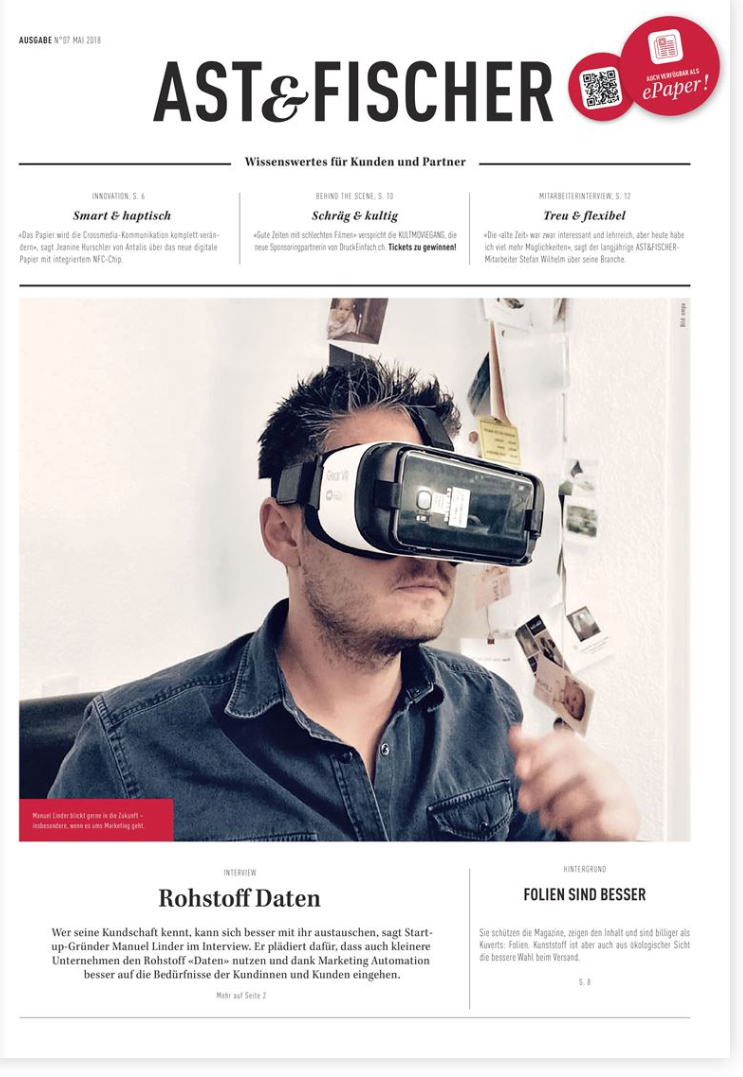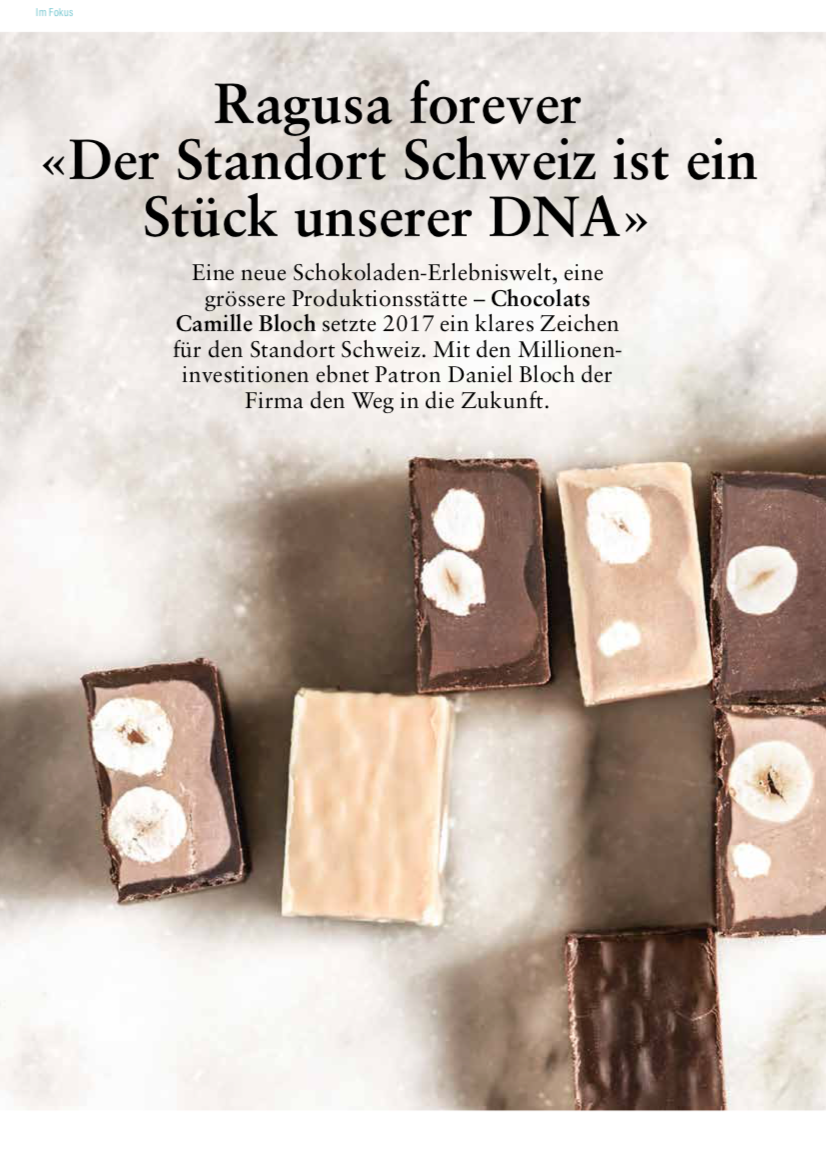Wechä Gäggeler ist seit Jahren Gigathlet. Nun ist er einer von denen, die er immer mit viel Bewunderung und etwas Abscheu als Spinner bezeichnet hatte: ein Single. Mit Hilfe seiner Supporter, die in den Wechselzonen bei Hitze und Gewitter stundenlang warteten, um in den entscheidenden Minuten bereit zu sein.
Es ist der schwarze Bändel am Handgelenk, der alles ausmacht. Wen Werner «Wechä» Gäggeler im Gigathon-Camp in Olten auch trifft, man blickt sich nicht in die Augen, sondern auf den Bändel. Hier ein ungläubiger Blick, dort ein Hauch von Erstaunen – Wechä Gäggelers Bändel ist schwarz. Nicht orange wie jene der Team-of-five-Athleten. Auch nicht grau wie bei den Couples. Er hat den Schritt gewagt: Nach etlichen Gigathlon-Jahren im Fünfer- und Zweierteam startet er nun alleine: Je fünf Etappen an zwei Tagen, insgesamt 92 Kilometer Inline, 12 Kilometer Schwimmen, 96 Kilometer Bike, 198 Kilometer Rad und 52 Kilometer Laufen. Über 7500 Höhenmeter. Ohne Ablösung. Fast ohne Pause.
Wechä Gäggeler ist kein Hardcore-Athlet. Er ist auch kein geborener Ausdauersportler. Aber er ist einer, der eine Vision hatte. Und nun nur noch ein paar Stunden davon entfernt ist, seinen Traum zu realisieren. «Früher habe ich immer gedacht: ,Was sind das nur für Spinner!‘ Ich wollte mir beweisen, dass ich auch spinnen kann», sagt Gäggeler. Doch er weiss: Es ist nicht sicher, dass er das Ziel vor dem Besenwagen erreichen wird.
Jedes Ding an den richtigen Ort
Es ist Freitagabend. Gäggeler sitzt mit seinen zwei Supportern im Camper. Während rundherum hunderte Gigathleten darauf warten einzuchecken, sind sie hochkonzentriert am Packen. Für jede Disziplin gibt es einen Sack. Trikots, Ersatzpneus, Kraftgel, Salztabletten – jedes Ding muss an den richtigen Ort. Socken eingepackt? Startnummern angeheftet? Alles muss exakt geplant sein.
Gäggelers Supporter werden zwei Tage lang ganz in seinem Dienst stehen. «Die beiden sind massgeblich daran beteiligt, dass ich immer mehr will», sagt Gäggeler: Sein langjähriger Freund Michael Aebischer (43), Vater von vier Kindern, der 1999 mit dem TransSuisse die gemeinsame Gigathlon-Serie begann. Damals war Gäggeler sein Supporter. Und Simone Ryser (42), seine Couple-Partnerin. Sie wäre eigentlich fit genug, um selbst am Gigathlon zu starten. Aber sie zögerte keinen Moment, ihn zu unterstützen. Sie freue sich, einmal auf dieser Seite des Gigathlon zu stehen, sagt sie.
Stimmung zwischen Openair und Volkslauf
Vier Disziplinen-Wechsel gibt es pro Tag. Viermal umziehen, Schuhe wechseln, Nahrung tanken. Jedes Mal an einem anderen Ort. Während die Supporter den Gigathleten in vergangenen Jahren von Ort zu Ort im Auto hinterherreisten, ist der Gigathlon 2012 autofrei. Das heisst für die Supporter: Sie tragen das ganze Material von Wechselzone zu Wechselzone.
Das Team sucht sich einen Weg durchs Gigathlon-Camp. Durch die hunderten roten Zelte, die Stände der Sponsoren. Durch das Gewimmel von Musik, Farben und Gerüchen. Die Stimmung schwankt zwischen Openair und Volkslauf. Im Oltener Eishockeystadion wird der Gigathlon eröffnet. Wechä Gäggeler kennt fast jeden. Er ist immer gut gelaunt, hat immer gute Sprüche parat. Jeder freut sich, ihn zu sehen. Und jeder richtet als erstes den Blick auf den Bändel. Erstaunt, erfreut, neidisch. Gäggeler wird nervös. Aber er kann beruhigt schlafen - seine Supporter haben alles im Griff.
Gigathleten zelebrieren Leidenschaft zum Sport
Samstagmorgen, 3.30 Uhr. Heute ist Gäggelers Geburtstag. Ein Müesli zum Frühstück. Die lange Inline-Strecke geht in die Beine. Simone Ryser wartet bei der Wechselzone in Altreu, wo sie Gäggeler in den Neopren steckt und ihn motiviert fürs Schwimmen, seine schwächste Disziplin. 9 Kilometer aareabwärts bei schwächster Strömung sind jedoch ein harter Brocken. So weit ist er noch nie am Stück geschwommen. Irgendwann kann er nicht mehr, hält bei einem Boot und fragt, wie weit es noch sei. Er ist erst in der Hälfte.
Michael Aebischer wartet derweil bereits in Solothurn. Mountainbike, Notvorräte, Sonnencreme und Handy liegen in der dicht gedrängten Wechselzone am Boden. Neben Campingstühlen, Rucksäcken und Helmen. Warten ist eine der Hauptaufgaben der 820 Supporter. Stundenlanges Warten, um dann in den entscheidenden Minuten parat zu sein. Aebischer ist jedoch nicht allein. Man kennt sich in der Single-Wechselzone. Man hilft sich aus. Hält zusammen in der mörderischen Hitze.
Aebischer beobachtet die Singles, die nun zahlreicher in die Wechselzone kommen, um sich gleich wieder mit dem Bike den Weg durchs Gewimmel zu bahnen. Es wurmt ihn nur zuzusehen, wie die anderen Vollgas geben und ihre Leidenschaft zum Sport zelebrieren. Er, der sich seit langem am Biennathlon mit Gäggeler duelliert. Doch der Gigathlon 2012 war für Aebischer kein Thema - er hatte im November seine Achillessehne gerissen. Ein guter Grund, stattdessen seinen Freund zu betreuen.
Dank Supportern kurz abschalten
Und dann kommt er. Aebischer lotst Gäggeler zum seinem Platz im Chaos der Wechselzone. Gäggeler strahlt. Die Schwimmstrecke habe ewig gedauert, sagt er. Raus aus dem Neopren, abtrocknen, Velotrikot an, Schuhe, Trinken, Sonnencreme. Gäggeler setzt sich gelöst auf den Campingstuhl. Plaudert, isst ein paar Nüsse. Er ist zufrieden mit seiner Form. Müde, aber motiviert. Dank seinen Supportern kann der Gigathlet in der Wechselzone kurz abschalten. Und sie sind es, die ihn wieder auf die Piste schicken und es nicht zulassen, dass er in der Wechselzone liegen bleibt.
Aebischer nimmt Gäggelers Bike und die beiden verschwinden im Gewimmel. Vier Stunden wird der Gigathlet für die nächste Etappe haben. Vier Stunden auf und ab, ohne Unterbruch. Und das in der grössten Mittagshitze und zum Teil durch den Morast, bis nach Oensingen. Danach folgen über fünf Stunden auf dem Rennvelo, während die Schnellsten schon lange im Camp am Duschen sind.
Weshalb tut er sich das an? Vielleicht macht er es für sein Ego. Um sich zu beweisen, dass er mit seinen 43 Jahren noch zu so etwas fähig ist. Vielleicht wegen der Anerkennung. Vielleicht ist es die Angst vor dem Älterwerden. Wann, wenn nicht jetzt?, hatte er sich am letztjährigen Gigathlon gefragt.
Im Ziel ist am Start
Es ist 18 Uhr in Sissach. Gäggeler ist noch auf dem Rennvelo unterwegs. Das Warten geht weiter, zu Swing und Sonne. Es ist nach sieben Uhr, als er eintrifft. Er nimmt es gemütlich, er hat keinen Stress mehr. Das einzige Ziel ist jetzt, noch die letzte Etappe zu schaffen, die 24 Kilometer Laufen. Er lacht noch immer, doch er ist erledigt. Zu hart war die Strecke. Die fiesen Steigungen, immer und immer wieder. Zu heiss die glühende Hitze. Er kann kaum etwas essen und trinken. Aebischer besteht aber darauf, drückt ihm ein Biberli und ein Becher Cola in die Hände. Gäggeler muss sich hinlegen. Er beginnt zu zweifeln, ob sein Traum noch realistisch ist. Aebischer befiehlt ihm, weiterzukämpfen. Aufgeben ist kein Thema. Heute nicht. Aber morgen?
Endlich läuft Gäggeler los. Aebischer würde ihn gerne begleiten. So wie früher, als die Supporter die Gigathleten noch mit dem Bike begleiten und auf der Strecke betreuen durften. Er würde ihn beschwatzen und mit ihm lachen. «Wir hätten es lustig», ist er überzeugt. Nun wird Gäggeler alleine durch den Wald rennen, im Dunkeln – ohne die dringend nötige Stirnlampe, die im Camper blieb. Er wird daran zweifeln, ob er es noch bis ins Camp schafft. Die Beine wollen sich nicht an den Rhythmus des Laufens gewöhnen. Es ist 23.15 Uhr nachts, als Wechä Gäggeler nach über 17 Stunden im Ziel einläuft, Arm in Arm mit zwei anderen Läufern. Er strahlt, ist glücklich. Aber zuversichtlich ist er nicht. «Morgen könnt ihr ausschlafenl», sagt er seinen Supportern. Unvorstellbar erscheint es ihm, in ein paar Stunden schon wieder loszufahren, das Ganze von vorne. Geburtstagsparty wird es keine mehr geben.
Der Besenwagen im Rücken
Es ist Sonntag. Der blaue Punkt auf dem Tracker bewegt sich vorwärts, es sind Gäggelers Lebenszeichen. Simone Ryser und Michael Aebischer reisen wieder von Wechselzone zu Wechselzone. Sie wechseln sich wie immer ab, damit die Wege mit dem Zug kürzer werden. Von Olten nach Nottwil, über Sursee nach Rothrist, dann nach Oensingen und wieder zurück nach Olten. Dieses Mal nicht durch die Hitze, dafür durch Blitz und Donner. Ein Hagelsturm deckt die Inline-Strecke zu, Bäche fliessen über die Bike-Singletrails. Der blaue Punkt bleibt nie stehen, das ist ein gutes Zeichen. Der zweitletzte Wechsel klappt nicht gut, es regnet in Strömen, Aebischer ist nicht parat. Der Camelbag mit dem Wasser für die Laufstrecke bleibt liegen. Doch Wechä Gäggelers blauer Punkt im GPS kriecht weiter, den Besenwagen im Rücken seinem Ziel entgegen. Seinem Traum, nicht nur einen schwarzen Bändel zu tragen, sondern mit ihm das Ziel vor Wettkampfschluss zu erreichen. Um sich danach noch höhere zu stecken. Seine Supporter erwarten ihn im Dunkeln.