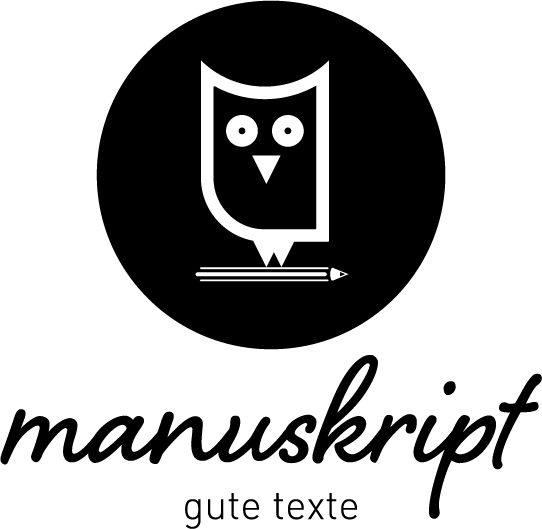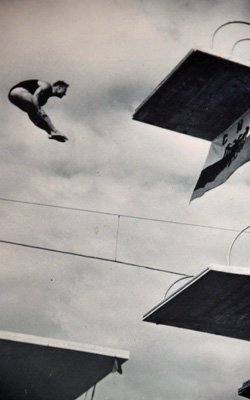Sieben Tage lang durfte ich den Fackellauf durch Griechenland begleiten, von der Entzündung des olympischen Feuers in Olympia bis zur Übergabe an Sebastian Coe, den Präsidenten des Organisationskomitees von London 2012. Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses ganze Ereignis einmal erleben durfte. Es waren sieben interessante und für mich als Olympiasammler sehr bereichernde Tage. Eine grosse Enttäuschung bleibt aber, denn ich hatte gehofft, dass auch ich einen Teil mit der Fackel in der Hand absolvieren dürfte, aber das Versprechen seitens des Griechischen Olympischen Komitees wurde leider nicht eingehalten. Ich hatte es mir einfacher vorgestellt, doch sie hatten bereits alles durchgeplant. Mein Trost: In Rio 2016 werde ich auf jeden Fall Fackelläufer sein, das habe ich bereits in die Wege geleitet. Wahrscheinlich werde ich durch den Urwald rennen.
Wir - zwei weitere Olympiasammler und ich - hatten eine Akkreditierung, mit der wir überall rein und raus konnten. Wir konnten deshalb sehr vieles erleben. Wir lernten Griechenland kennen, es ist ein wunderschönes Land. Es ist unglaublich, welche Logistik hinter dem Fackellauf steckt. Der Ablauf war jeden Tag ähnlich: Der Auto-Konvoi des Fackellauf-OKs fuhr ins nächste Städtchen, durch das der Fackellauf führte und sich die lokale Prominenz zusammengefunden hatte, stellte als erstes die grosse Schüssel auf und bereitete alles vor. Dann wartete man auf den Fackelläufer, der das Feuer entzündete.
Und dann begann das Rahmenprogramm, meistens folkloristische Tänze. Und die Reden. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Reden in so kurzer Zeit gehört! Die Griechen lieben Reden! Am Schluss der Zeremonie entzündete der nächste Fackelläufer seine Fackel und lief los. Und die Festlichkeiten zogen weiter: Alles wurde eingepackt, um am nächsten Ort gleich wieder ausgepackt und aufgestellt zu werden. So ging es sieben Tage lang, täglich zwei bis drei Mal. Wir drei Olympiasammler fuhren immer am Schluss des Auto-Trosses. Das passte, denn jedes der 16 Autos hatte seine Funktion: In einem waren die Sicherheitsleute, im nächsten die Organisatoren der Zeremonien oder jene, die die Unterkünfte organisierten. Und am Schluss eben wir, die «Touristen».
Leider haben wir nicht allzu viele Beteiligte des Fackellaufs näher kennengelernt. Die Griechen nahmen uns als Störfaktor wahr, was die Kommunikation mit ihnen erschwerte. Erst gegen Schluss war es möglich, Gespräche mit ihnen zu führen.
Abends hatten wir unser eigenes Programm. Und manchmal liessen wir auch eine Zeremonie aus. Und machten stattdessen das Postamt der Stadt ausfindig. Mein Sammlerkollege, mit dem ich unterwegs war, ist Olympia-Philatelist. Das heisst, er sammelt Olympia-Briefmarken und alles darum herum. In den grösseren Städten, durch die die Fackel getragen wurde - insgesamt sieben -, gab es einen Olympia-Sonderstempel. Mein Kollege setzte alles daran, jeden einzelnen dieser Stempel zu erhalten. Mitsamt Sonderumschlag und spezieller Olympia-Briefmarke (wenn auch die olympischen Ringe wegen den IOC-Gebühren jeweils nicht drauf waren). Er war unglaublich hartnäckig und machte auch vor einem geschlossenen Postbüro nicht Halt. So auch an jenem Sonntagabend, als er den Postchef, der in Athen weilte, überredete, die Postfiliale nur für uns öffnen zu lassen. Diese philatelische Schatzjagd war ein Teil unserer Reise. Ich kenne nun wohl jedes Postamt Griechenlands. Das war natürlich auch für mich spannend. Aber ich bin kein Philatelist - mich interessiert das Olympia-Design. Das Darum-Herum von Olympischen Spielen. Ich sog auf der Reise jedes Detail auf.






So etwa alles rund um die Fackel. Wie die Kisten mit den Fackeln am neuen Ort aus dem Lastwagen gehoben wurden. Oder wie der Engländer - er war Mitdesigner der Fackel - jede Fackel eigenhändig zusammenschraubte. Er hatte eigens dafür ein Gestell gebaut, damit es schneller ging. Das fand ich unglaublich spannend. 600 Fackelträger durften das Feuer in Griechenland weitergeben. 8000 werden es in England sein, bis das Feuer am 27. Juli in London ankommen wird. Insgesamt wurden 12 000 Fackeln produziert. Die 8600 Fackelträger dürfen ihre Fackel behalten, die restlichen 3400 werden an wichtige Leute verschenkt. Ich habe leider noch keine ergattert für mein Olympia-Museum. Noch sind sie zu teuer.
Als «Olympic Design»-Kenner interessiere ich mich natürlich sehr fürs Design der Fackel. Ich finde sie ok. Sie ist kein Traum, aber auch nicht schlecht. Solides Design, aber ohne richtige Idee dahinter. Sie ist golden, das ist ein Novum, das hat es noch nie gegeben. 8000 Löcher stehen für die 8000 Läufer in England, das Dreieck steht für die drei olympischen Grundideen Höchstleistung, Respekt und Freundschaft. Das ist nicht sehr kreativ. Vor allem, wenn man sie mit früheren Fackeln vergleicht!
Athen: Die Fackel hatte die Form von Olivenbaumblättern in getrockneter Form. Sydney: Das Design der Fackel war inspiriert von den Bögen des Opera House. Und von einem Boomerang. Peking: Die Fackel als Papyrus, diese Fackel war wahnsinnig schön. Sie alle hatten eines gemeinsam: eine Geschichte. Die Geschichte des jeweiligen Landes. Die Fackel von London hat keine Geschichte. Sie ist eine funktionstüchtige Fackel und fertig. Das gleiche gilt übrigens auch für die weiss-goldene Uniform. Das enttäuscht mich, da hätte ich von London mehr erwartet. Alles ist konservativ, etwas langweilig, ohne Geschichte dahinter. Auch die Medaille! Über die Medaille von Peking 2008 könnte man ein Buch schreiben. Jene von London: ohne Geschichte. Dabei gäbe es in London viele gute Designer. An früheren Olympischen Spielen versuchten die Designer, den Sachen eine Seele zu geben. In London sind sie einfach nur eines: nüchtern. Am schlimmsten sind die Piktogramme. Jene von Athen waren wunderschön, antiken Vasenmalereien nachgebildet. Jene von London sehen aus, als hätte sie ein Kindergartenkind gezeichnet. Keine schönen Formen, unausgeglichen. Das ist schlimm.
Ein persönliches Highlight der Reise war für mich die Begegnung mit der Design-Chefin von Athen 2004. Mit ihr konnte ich ewig über Olympiadesign, Ideen und Visionen fachsimpeln. So habe ich beispielsweise die Idee, ein Designprogramm für Olympische Spiele aufzugleisen. Bisher musste jeder Austragungsort von Null anfangen. Dabei könnte das neue OK von den früheren Austragungsorten profitieren. Ich habe in meinem Olympiamuseum alle nur möglichen Informationen zum Design von allen Olympischen Spielen gesammelt. Diese Informationen möchte ich zugänglich machen.
Grundsätzlich bin ich beeindruckt, wie professionell die Griechen - entgegen ihrem Ruf – den Fackellauf organisierten. Man merkte, dass sie dies nicht zum ersten Mal machten. Ich habe insbesondere das Ambiente im Panathinaiko-Stadion, dem ersten Olympiastadion der Neuzeit, ganz tief in mich einwirken lassen. Ich konnte mir richtiggehend vorstellen, wie die Spiele damals, 1898 waren. Und auch hier interessierten mich natürlich insbesondere die Details: Wie waren damals die Stühle nummeriert? Wie organisierte man die Eintrittskarten? Wo sass die Königin?
Sehr speziell war auch die Zeremonie an der türkischen Grenze. Wir drei Olympiasammler waren die einzigen Zuschauer, die restlichen Leute waren alles ranghohe Offizielle oder Polizisten. Das Ganze war skurril, insbesondere, wenn man an das angespannte Verhältnis zwischen den Türken und den Griechen denkt. Da war auf der einen Seite die griechische Fahne, auf der anderen die türkische, zwei Wächter und dazwischen ein Fluss und eine Brücke. Mitten in der Pampa. Die Türken kamen über die Brücke, es wurden Hände geschüttelt und in der Mitte der Brücke das Feuer angezündet. Ich rechnete damit, dass die Griechen den Türken eine Fackel schenken würden. Das wäre doch ein guter Moment gewesen, ein Zeichen zu setzen, schliesslich ist Freundschaft einer der Hauptpfeiler der Olympischen Spiele. Doch der OK-Chef des Fackellaufs drückte dem türkischen NOK-Präsidenten einen Pin in die Hand. Einen Pin!! Ob das eine Provokation war?
In der Schlusszeremonie in Athen kamen dann die Stars. David Beckham war da. Und Prinzessin Anne, die Tochter von Königin Elisabeth II., sie ist IOC-Mitglied. Es war sehr schön, so nah dran sein zu dürfen. Der Präsident vom Griechischen Olympischen Komitee erhielt das Feuer von der Oberpriesterin, die bereits bei der Entzündung des Feuers am ersten Tag dabei war. Dann entzündete er mit der Fackel zusammen mit Prinzessin Anne ein Lämpli und ging mit ihr Hand in Hand aus dem Stadion. Und schon ging der Fackellauf weiter. Nun aber in England.
Markus Osterwalder ist Grafiker und Olympiasammler. Sport ist für ihn Nebensache - sein Herz schlägt für das Design von Olympischen Spielen. In London 2012 wird er wie an vergangenen Olympischen Spielen erneut auf die Suche gehen nach den kleinen Details.
Bilder: Markus Osterwalder
Text: aufgezeichnet von Manuela Ryter
Anmerkung: Dieser Artikel wurde für den Olympiablog verfasst.