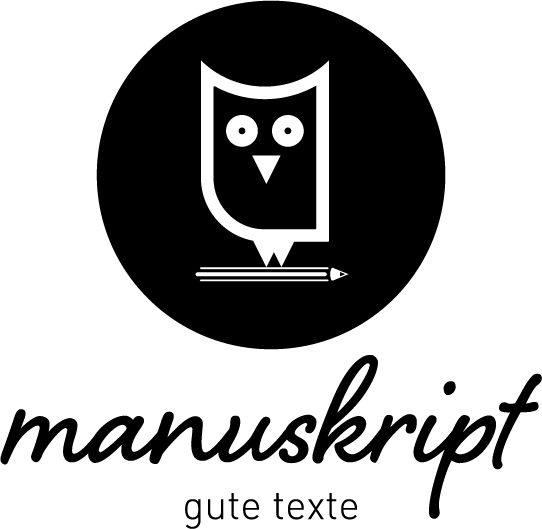Liselotte Kennel trainierte im Rheinbad Schaffhausen in einem 70-Meter-Becken flussabwärts. Und trotzdem schaffte sie es nach London an die Olympischen Spiele 1948. Olympia hat nicht nur ihre Liebe zu Amerika geweckt und damit ihr Leben verändert, sondern auch ihre Motivation, sich für den Sport – und insbesondere für die Rechte der Frauen im Sport – einzusetzen.
Hellblau schimmert das Wasser im Schwimmbad in Liselotte Kennels Garten am Sonnenhang Balsthals. Der Rasen ist frisch gemäht, die Rosen blühen. Unter einer Pergola warten weisse Plastikstühle auf den Sommer. Doch das kühle Nass stiehlt Blumen und Dekoration die Aufmerksamkeit. Das Wasser ist das Zentrum von Kennels Garten. Und der rote Faden in ihrem Leben. Liselotte Kennel – sie wird seit jeher «Lilo» genannt – setzt sich für das Fotoshooting auf den Rand des Beckens. Hier schwimmt sie an warmen Tagen ihre Runden und hält sich fit. Auch mit 82 Jahren noch.
Kennel blinzelt, es ist der erste sonnige Tag seit langem. In ihrem Gesicht verraten nur die Falten ihr wahres Alter. Ihr Blick hingegen zeigt eine Frau mit der Energie eines jungen Menschen. Einer Frau, die noch ganz viel vorhat im Leben. Die das Leben nicht hinnimmt, sondern dieses mitgestaltet. Die mit Fröhlichkeit und Nachdruck für ihre Anliegen kämpft. Sie lacht in die Kamera und erzählt von früher. Von ihrer Karriere als Schwimmerin. Von den Olympischen Spielen in London 1948 und Helsinki 1952. Von ihrer Laufbahn als eine der ersten Sportlehrerinnen ETH und als einzige Frau im Zentralvorstand des Schweizerischen Landesverbandes für Sport (SLS, heute Swiss Olympic). Es ist die Geschichte einer Frau, die mit Talent zum Sport kam und sich später mit Leidenschaft für den Sport einsetzte – und für die Rechte der Frauen im Sport.
Wer Talent hatte, kam weit
Naiv und stürmisch war der Sport damals in den 50er Jahren. Sportler genossen kein grosses Ansehen – Sportlerinnen schon gar nicht. Dafür war der Spassfaktor umso grösser. Von Leistungstests und Zeitlimiten redete noch niemand. «Nicht einmal Krafttraining kannte man», sagt Kennel, «es war eine schöne Zeit. Nicht verbissen, alles war spielerisch.» Die Wettkämpfe von damals waren ein fröhliches Kräftemessen, es gewann nicht jener, der am meisten trainiert hatte, sondern wer am talentiertesten war. Solche Wettkämpfe findet man heute höchstens noch bei den Kindern. Oder in Randsportarten.
Liselotte Kobi, wie sie damals hiess, hatte Talent. Vor allem im Brustschwimmen. Als junges Mädchen war sie quirlig und bewegte sich viel. Eines Tages nahm sie an einem Schwimmwettkampf teil. Und gewann. Von da an schwamm sie im Schwimmklub Schaffhausen, Trainer war ihr Turnlehrer. Schwimmbad hatte es zwar kein richtiges, aber es gab das Rheinbad, in dem bei jeder Temperatur trainiert wurde. Wegen der Strömung mussten die Schwimmer am Ende des 70-Meter-Beckens aussteigen und zu Fuss zurückgehen. Länge für Länge. Eine Trainingseinheit über 600 Meter war «das höchste aller Gefühle». Die Wende musste sie in einem anderen Schwimmbad üben.
«Das waren Pfahlbauerzeiten»
Einmal pro Woche durfte die junge Schwimmerin in Thayngen mit den Männern trainieren. Das war eine Ehre für sie, denn in den Schwimmbädern waren Männer und Frauen sonst strikte getrennt. Kennel fuhr die 20 Kilometer mit dem Velo hin und wieder zurück. Und damit sie auch im Winter trainierten konnte, wünschte sie sich zu Weihnachten jeweils ein 10er-Abo für den Zug nach Zürich, denn dort gab es ein Hallenbad.
Bald gewann «Lilo» Regionalmeisterschaften. 1946 machte sie als 16-Jährige erste Schweizerrekorde, die jeweils am Radio verkündet wurden. Den Rekord in 200 m Brust unterbot sie gleich um 30 Sekunden. «Verglichen mit heute waren das Pfahlbauerzeiten!», sagt Kennel und lacht. Dafür habe man sich nicht geschunden wie heute, «das ist ja grauenhaft, wie die Schwimmer heute trainieren!» Niemals hätte sie das mitgemacht, sagt sie mit Nachdruck.
Gute Betreuung dank «Megge» Lehmann
1947 ging es nach Monaco an die EM. Begleitet wurde das Schwimmteam von Max «Megge» Lehmann, dem späteren Radio- und Fernsehpionier, der von da an die treibende Kraft Elite-Schwimmerinnen war: «Er konnte uns begeistern», sagt Kennel.
Lehmann war es denn auch, der aus den Olympischen Spielen ein unvergessliches Erlebnis machte für die drei Schweizer Olympia-Schwimmerinnen Liselotte Kobi, Doris Gontersweiler (heute Santschi), mit der Kennel bis heute gut befreundet ist, und der Tessinerin Marianne Ehrismann. Denn: «Die Vorbereitungsphase war lausig», sagt Kennel.
Liselotte Kobi mit Doris Gontersweiler und Marianne Ehrismann: «Ein Wunder, dass wir keine wollenen Anzüge hatten!»
Noch heute strahlt Kennel, wenn sie von «Megge» erzählt. Die Schwarz-Weiss-Fotos im vergilbten London-1948-Album zeigen einen gutaussehenden Mann. Lehmann war der «Beschützer» der jungen Mädchen, er machte alles für sie und nannte sie «meine Töchter». Und sie himmelten ihn im Gegenzug an. Die meisten anderen Schweizer Athleten in London 1948 hatten da nicht so viel Glück und mussten ihre Wettkämpfe ohne jede taugliche Betreuung bestreiten, da die zuständigen Personen eher als VIP-Gäste denn als Betreuer in London waren.
Zusammenzug in der Männerbastion Magglingen
Für die Olympischen Schwimmwettkämpfe 1948 wurden alle Schweizer Landesrekordhalter selektioniert. In Romanshorn mussten sie bestätigen, dass sie «fähig» waren für Olympia. Sie erhielten eine Uniform, an die ihre Eltern bezahlen mussten, und in Magglingen, wo Sportler bereits damals im «Vorunterricht» als angehende Soldaten gefördert wurden, gab es einen einmaligen Zusammenzug des Olympia-Schwimmteams.
«Das war ein Highlight», sagt Kennel: «Magglingen war sehr hoch im Kurs bei den Sportlern. Es war eine Männerbastion, fest in militärischen Händen. Wir fühlten uns wahnsinnig geehrt, dass wir dort bei 16 Grad Wassertemperatur trainieren durften.» Auch in Magglingen gab es damals noch kein Hallenbad.
Nach langem hin und her gab auch das Lehrerseminar, das Kennel besuchte, grünes Licht. «,Megge‘ musste unterschreiben, dass er auf uns aufpasst», sagt Kennel und lacht. Sie war es gewohnt, von ihren Lehrern eher Spott als Anerkennung zur erhalten für ihre sportlichen Leistungen. Eine Erfahrung, die sich in der jungen Frau einbrannte und sie prägte.
Eröffnungsfeier war «enorm beeindruckend»
Und dann kam der Tag, an dem sie mit den anderen Athleten der Schweizer Delegation per Schiff nach London reiste, immer «lieb überwacht» von Lehmann. Auf der Fahrt lernte sie den Leichtathleten Armin Scheurer kennen, Schweizer Fahnenträger in London und laut Kennel «damals eine Kapazität». Es blieb zu ihrem Bedauern fast die einzige Bekanntschaft mit anderen Olympia-Athleten – insgesamt nahmen in London über 4100 Sportler teil, darunter 390 Frauen. Einzig vor der «enorm beeindruckenden» Eröffnungsfeier – sie mussten stundenlang im Park warten, bis sie ins Wembley-Stadion einmarschieren durften –, hatten sie noch einmal Gelegenheit austauschen.
Drei Schwimmerinnen auf Sightseeing-Tour in London...
Während den Spielen waren sie von den anderen völlig abgeschottet, ein olympisches Dorf gab es damals noch nicht: Alle Teams der Schweizer Delegation hatten andere Unterkünfte. Zuerst wohnten die drei Schwimmerinnen in einer Haushaltungsschule, weit weg von den Wettkampfstätten und von ihrem Betreuer Lehmann. Das Essen sei sehr schlecht gewesen, erinnert sich Kennel. Die Lebensmittel seien – wie in der Schweiz – auch nach dem Krieg noch rationiert worden. «Zum Glück hatte ich noch eine Büchse Ravioli dabei.» Die Enttäuschung war gross. Lehmann sorgte dafür, dass die Mädchen umziehen konnten – in eine Unterkunft, wo Athletinnen aus Jamaika und Frankreich wohnten.
Big Ben ist kein Mensch
«Einmal durften wir zu den Männern ins Camp Uxbridge, wo sie zusammen mit den Amerikanern wohnten», sagt Kennel, «dort hatten sie alles!» Bis heute sieht sie deren Buffet vor ihren Augen. Im Camp sangen die Schwimmerinnen mit den Amerikanern Lieder, begleitet von Megge Lehmann und seiner Gitarre.
Kennel sah sich auch viele Leichtathletik-Wettkämpfe an. Und an den Sonntagen standen Stadtrundfahrten auf dem Programm. Die drei Schwimmerinnen waren beeindruckt von der Grossstadt London, von der sie nichts wussten, «ausser dass der Big Ben kein Mensch ist». Sie hätten in den zwei Wochen so viele schöne Sachen gesehen in London, erzählt Kennel. «Wir standen einfach da und staunten.»
Die einzige Schweizerin im Halbfinal
Der Schwimmwettkampf fand gegen Ende der zwei Wochen in London statt. Einmal wurden die drei jungen Frauen – als einzige Passagiere – von einem doppelstöckigen roten Bus abgeholt und zum Empire Pool chauffiert. Lilo Kennel startete auf Bahn 4. 200 Meter Brust. Sie gab alles und landete – als einzige des Schweizer Schwimmteams – «glücklich im Halbfinal», wie sie mit der Unbeschwertheit von damals erzählt.
Schöne Erinnerungen: Liselotte Kennel (Mitte) nach der Quali mit Megge Lehmann und Doris Gontersweiler.
Nervosität kannte Kennel nicht – auch nicht, als sie im Halbfinal auf dem «Böckli» stand. Sie sah Armin Scheurer am Bassinrand, er feuerte sie an, er schrie und ruderte mit den Armen. «Das kann man sich heute an Olympischen Spielen nicht mehr vorstellen!», lacht Kennel. Sie genoss es, sich mit anderen Nationen messen zu dürfen. In ihrem vergilbten Buch kleben die Ranglisten der Halbfinale. Kennel studiert die Zeiten. «Ich wurde jedenfalls nicht letzte», schmunzelt sie.
Amerikaner mit «Sexappeal»
Die Stars in London 1948 waren die Amerikaner. In Kennels Buch von damals sind sie in modischen Badeanzügen abgebildet. «Die hatten Sexappeal!», sagt Kennel und lacht. Die junge Frau bewunderte die muskulösen Athleten – und ihr gefiel die amerikanische Hymne: «Sie ist so lieblich sanft, um gleich darauf stark und prägnant zu ertönen.» Die Siegerehrungen in London wurden zu einem Schlüsselerlebnis in Kennels Leben: «Ich sagte mir damals in London: Ich will nach Amerika. Ich wollte wissen, ob auch die Menschen dort sind wie ihre Hymne.»
«Immer Amerika»: Die amerikanische Hymne ertönte in London 1948 häufig - und veränderte Kennels Leben.
Nach den Spielen absolvierte Kennel an der ETH als einzige Frau ein Sportstudium. Ihren späteren Ehemann, mit dem sie bis heute zusammenlebt und den sie seit 30 Jahren pflegt, lernte sie in der Studenten-Ski-Nationalmannschaft kennen. 1952 nahm sie an den Olympischen Spielen in Helsinki teil und beendete ihre Schwimmkarriere. Danach arbeitete sie als Primarlehrerin, um Geld zu verdienen für die Fahrt nach Amerika. 1955 machte sie ihren Traum war. Sogar die Zeitung berichtete über die junge Frau, die alleine nach Amerika reiste. In Rochester musste sie zuerst ein halbes Jahr in einem Haushalt helfen – das war vorgeschrieben. Danach ging sie in den Osten, wo sie einen Winter lang als Skilehrerin arbeitete. Im Sommer folgte Kalifornien, nun verdiente sie ihr Geld als Schwimminstruktorin. Sie war beeindruckt, welchen Stellenwert der Sport in Amerika genoss.
Die Olympischen Spiele haben ihr Leben geprägt
«Die Olympischen Spiele haben mein Leben verändert», sagt Kennel heute. Die Spiele brachten sie nach Amerika und Amerika prägte die junge Frau fürs Leben. Sie setzte sich zeitlebens für den Sport und den Schwimmverband ein. Und für die Frauen: Sie übernahm die SLS-Kommission «Sport und Frau» und wurde darauf als einzige Frau in den Zentralvorstand des Landesverbandes für Sport einberufen. Sie kämpfte dafür, dass die Frauen selbstsicherer wurden. Dass auch sie Eishockey und Fussball spielen durften. Dass auch die Sportlerinnen gefördert wurden. Heute sei sie ruhiger geworden, sagt Kennel. Bei gesundheitlichen Schwierigkeiten zucke sie mit den Schultern und sage, sie sei halt «nicht mehr 80». 82 ist aber noch lange nicht 100. Und Lilo Kennel hat noch viel vor in ihrem Leben.
2012 finden die Olympischen Spiele in London statt – nach 1908 und 1948 bereits zum dritten Mal. Wir haben uns auf die Suche nach den Schweizer Olympioniken von London 1948 gemacht. Und haben einige von ihnen besucht.
Bereits erschienen sind die Beiträge über Turmspringer Ernst Strupler und die Herren des Rudervierers mit Steuermann.
Bilder: Manuela Ryter und zvg
Anmerkung: Dieser Artikel wurde für den Olympiablog verfasst.