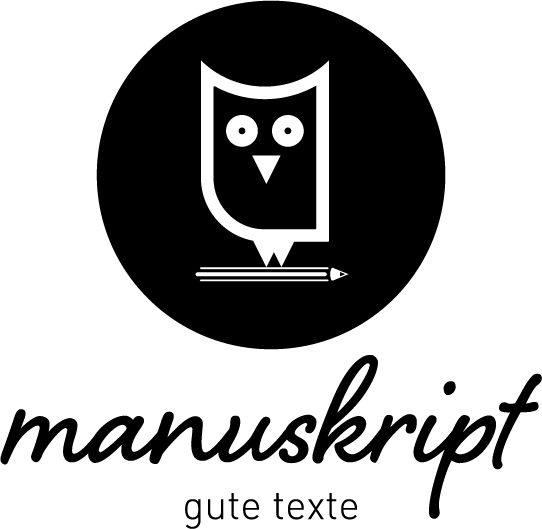Heldinnen der Aids-Waisen
Afrikas Grossmütter müssen für Kinder von aidskranken Eltern sorgen – Ältere Generation hat keine Altersvorsorge
In Afrika leben über 20 Millionen Menschen mit Aids. Das sind fast zwei Drittel aller HIV-positiven Menschen weltweit. Schweizer Entwicklungshilfen weisen auf die grosse Leistung und das Leid der älteren Generation hin.
Durch Aids stirbt in Afrika die Elterngeneration aus. Sie hinterlässt nicht nur Waisen, sondern auch verarmte alte Menschen. Grossmütter waren in Entwicklungsprojekten bisher jedoch kaum ein Thema. «Kinder sind für Entwicklungsprojekte viel interessanter. Doch es ist die Grosseltern-Generation, die zu den Hauptverlierern der Aidsepidemie gehört.» Das erklärt der Basler Kurt Madörin, der für das Hilfswerk «terre des hommes schweiz» gearbeitet hat und mit seiner Frau und vier Waisen in Tansania lebt. Der von ihm gegründete Verein Kwa Wazee und etwa 30 Entwicklungsorganisationen der Plattform «aidsfocus.ch» haben im Vorfeld des Welt-Aids-Tags mit einer Debatte in Bern die ältere Generation ins Blickfeld gerückt.
Betreuen statt betreut werden
«Grossmütter sind die wahren Heldinnen Afrikas: Sie sind es, die Aids-Kranke bis zu ihrem Tod pflegen und dann deren Kinder in Obhut nehmen», sagt der 69-jährige Madörin. Er selbst ist auf ihre Lage aufmerksam geworden, als er pensioniert wurde. «Ich fragte mich, wie alte Menschen in Afrika überleben.» Denn Renten gibt es keine, und die «natürliche Altersvorsorge», die Betreuung der Grosseltern durch ihre Familien, ist vielerorts aufgelöst: die Mütter sind gestorben und die Väter nach deren Tod weggegangen. «Viele Grossmütter werden ausgegrenzt und verarmen.» Sie seien vielen Belastungen ausgesetzt, berichtet Madörin: Sie müssen für Essen, Kleider und Schulhefte der Enkel aufkommen. Und diese wiederum müssen Arbeiten erledigen, die vorher ihre Eltern verrichteten und zudem die Grosseltern pflegen, wenn diese erkranken.
Madörin begann deshalb, einen Teil seiner Rente an Alte in Nshamba in der Provinz Kagera zu verteilen. Daraus entstand 2004 der Verein Kwa Wazee, der heute über 500 Grossmütter und deren Enkel mit minimalen Renten und einem Selbsthilfe-Programm unterstützt – mit dem Ziel, dereinst die tansanische Regierung für solche Leistungen zu gewinnen. «Bereits kleine Beträge haben erstaunliche Wirkung», betont Madörin. «Arme gehen höchst verantwortungsvoll mit Geld um.» Madörin ist überzeugt, dass monatliche Renten die Armut alter Leute und damit auch der Aidswaisen lindern.
Spenden für Renten
Erfahrungen der deutschen Entwicklungsagentur GTZ bestätigen dies: «Soziale Grundsicherung durch direkte Geldhilfe ist günstig und effizient», sagt Experte Matthias Rompel. Die GTZ hat in Studien festgestellt, dass Grosseltern und deren Enkel zu den Ärmsten der Armen gehören. Gerade diese Gruppen könnten angesichts ihrer sehr beschränkten Kräfte kaum Selbsthilfeprogramme starten und so Unterstützung erhalten. «Deshalb braucht es Geld», sagt Rompel. Es handle sich um finanzierbare Summen, die die einzelnen Länder für Renten aufbringen müssten. Es liege an Organisationen der Zivilgesellschaft, sich mit Lobbyarbeit dafür einzusetzen. «Das Thema Alter und Aids wurde tatsächlich vernachlässigt», sagt Joseph Kasper vom Schweizerischen Roten Kreuz. Infolge der «aidsfocus»-Debatte hat er Informationen gesammelt und an Partner in Westafrika weitergeleitet.
Seine Bitte, bei Aidsprojekten vermehrt mit älteren Leuten zu arbeiten, wurde gut aufgenommen. «Wir konnten einen Funken entzünden», sagt «aidsfocus»-Koordinatorin Helena Zweifel.
«Gesundheits- und Entwicklungsexperten haben erkannt, dass nicht nur die sexuell aktive Bevölkerung von Aids betroffen ist, sondern auch ihre Eltern und die ältere Generation.» Mehr Lobbyarbeit für die Alten weltweit ist gerade wegen der demographischen Veränderungen von grosser Bedeutung. Laut Prognosen wird die Anzahl über 60-Jähriger bis 2050 von 600 Millionen auf 2 Milliarden steigen. Den stärksten Anstieg wird es mit 7 auf 20 Prozent in Entwicklungsländern geben.
Text: Manuela Ryter (infosüd)
Dieser Artikel erschien am 1. Dezember 2007 im St. Galler Tagblatt.